Bernhard Kosciuszko
KARL MAY'S DRAMA
Babel und Bibel

1978 Sonderheft der Karl-May-Gesellschaft Nr.10

1978 Sonderheft der Karl-May-Gesellschaft Nr.10
| Seite |
| Vorbemerkung | 3 |
| 1. | Karl May und das Theater | 4 |
| 2. | "Vorstudien, Übungen, Skizzen" | 5 |
| 2.1. | Vorstudien und Übungen | 5 | |
| 2.2. | Skizzen - Das Vorspiel-Fragment | 7 |
| 3. | Herausgabe und Aufnahme | 8 |
| 4. | Untersuchung des Dramas | 10 |
| 4.1. | Der Inhalt des Dramas | 10 |
| 4.1.1. | Die äußere Handlung | 10 | |
| 4.1.2. | Die innere (symbolische) Handlung | 14 | |
| 4.1.2.1. | Vorbemerkungen | 14 | |
| 4.1.2.2. | Die symbolische Handlung | 14 | |
| 4.1.3. | Die verschiedenen Leseebenen | 17 |
| 4.2. | Die Technik des Dramas | 24 |
| 4.2.1. | Die innere Technik (Dramaturgie) | 24 | |
| 4.2.2. | Die äußere Technik (Form) des Dramas | 25 |
| 5. | Zusammenfassende Wertung | 27 |
| 6. | Nachtrag | 30 |
| 7. | Schluß | 31 |
| Nachwort (von Hansotto Hatzig) | 32 |
| Karl May in den "Literarischen Silhouetten" | 34 |
| Karl Mays Skizze zu 'Babel und Bibel' (Eine Vergleichslesung) | 43 |
Zu unserem Titelbild:
"Thoreingang zu Dur-Sargon in Khoreabad (nach Places Rekonstruktion)" aus Fritz Rommel, Geschichte Babylons und Assyriens, Berlin 1885, Seite 104.
Babel und Bibel
Das Hauptaugenmerk der Karl-May-Gesellschaft richtet sich auf das Spätwerk Karl Mays. Eindeutig dem Spätwerk zuzuordnen ist auch Mays Drama 'Babel und Bibel'. Da das Drama schon immer im Schatten der gewichtigeren Romane stand, hielt ich es für an der Zeit, auch dieses Werk Karl Mays auf seine "Hochliteraturverdächtigkeit" hin zu untersuchen.
Eine erste Auseinandersetzung mit 'Babel und Bibel' findet sich im Karl-May-Jahrbuch 1920, in dem Dr. Max Finke im Rahmen seiner Sichtung 'Aus Karl Mays Nachlaß' Gedanken zum Drama und zu Mays eigener Stellungnahme zum Stück äußert. Ausführlicher beschäftigte sich bisher nur Hansotto Hatzig in seiner Sascha-Schneider-Monographie mit 'Babel und Bibel'; doch dort stand es natürlich auch nicht im Mittelpunkt der Betrachtung. Hans Wollschläger widmet dem Stück in seiner May-Biographie ganze 2 1/2 Seiten, und Arno Schmidt benutzte es als Aufhänger für seine literarischen Kapriolen. Für Otto Forst-Battaglia ist 'Babel und Bibel' "Ballast wie die Maysche Lyrik", er hat nur eine knappe Seite für Mays erstes "eigentliches" Werk übrig. Zu all dem kommt, daß von diesem Werk augenblicklich kein Original-Text auf dem Markt ist: der in Band 49 ('Lichte Höhen') vorliegende Text ist derartig korrumpiert, daß sich eine Vergleichslesung nahezu zu einer Abschrift des Originals ausweiten würde. (Nach Auskunft Hansotto Hatzigs enthält der Band 49 der Radebeuler Ausgabe den unbearbeiteten Text.)
Zu einer Arbeit, die sich ganz 'Babel und Bibel' widmet, bot sich mir Gelegenheit, als ich im Rahmen meines Staatsexamens eine schriftliche Hausarbeit anzufertigen hatte. Der als Gutachter vorgesehene Professor akzeptierte das ungewohnte Thema - und so entstand der Hauptteil des hier vorgelegten Textes vor gut einem Jahr. x)
Da Hansotto Hatzig mit meiner Meinung über die Aufführbarkeit des Dramas nicht übereinstimmt, bat ich ihn, zu meiner Arbeit ein Nachwort zu schreiben, damit mein in dieser Hinsicht vielleicht etwas zu hartes Urteil nicht das letzte Wort in Sachen 'Babel und Bibel' bliebe. Wer recht behalten wird, das zeige uns die Praxis, auf die wir alle mit Ungeduld warten.
| x) | Diese Arbeit ist über den Leihverkehr der KMG erhältlich. Der Mays Werk im Überblick darstellende Teil wurde weggelassen, der restliche Text bearbeitet. |
1. K a r l M a y u n d d a s T h e a t e r
In 'Mein Leben und Streben' schildert Karl May seine erste Begegnung mit dem Theater:
| "Da kam ein Tag, an dem sich mir eine Welt offenbarte, die mich seitdem nicht wieder losgelassen hat. Es gab Theater. Zwar nur ein ganz gewöhnliches, armseliges Puppentheater, aber doch Theater. ... Es wurde gegeben: 'Das Müllerröschen oder die Schlacht bei Jena'. ... Ich gab keine Ruhe, bis wir die Erlaubnis erhielten, nochmals zu gehen. Es wurde gespielt: 'Doktor Faust oder Gott, Mensch und Teufel'. ... Seit jenem Abende ist mir das Theater bis auf den heutigen Tag als eine Stätte erschienen, durch deren Tor nichts dringen soll, was unsauber, häßlich oder unheilig ist." (1) |
Zu diesem Eindruck gesellte sich das unmittelbare Theatererlebnis des Mitwirkenden: May durfte als Statist beim Gastspiel einer wandernden Schauspielertruppe mitwirken: "Die Menschen, die solche Stücke schrieben, die auf der Bühne gegeben wurden, kamen mir wie Götter vor." (2) Der tiefe Eindruck, den diese Begebenheit auf den jungen May (er war nach eigenen Angaben 9 Jahre alt - wahrscheinlich aber etwas älter) machte, ist nur zu verständlich; stellten doch die Wanderschauspieler in den abgelegenen Dörfern wohl die einzige Abwechslung dar. Die an die Schilderung der Jugenderlebnisse mit dem Theater anknüpfende Behauptung, schon damals Zukunftspläne gehabt zu haben, die genau auf das Drama 'Babel und Bibel' zielen, muß als Fabel des alten May abgetan werden.
Einige Jahre später, May war zum ersten Male straffällig geworden und schmiedete Pläne für eine Schriftstellerkarriere (nach seinen Angaben schon 1861/62 - doch sind bekanntlich so frühe Erzählungen von ihm noch nicht gefunden worden), taucht das Thema Theater erneut auf:
| "Die Welt als Bühne kennen lernen, und die Menschheit, die sich auf ihr bewegt! Und am Schlusse dieses schweren, arbeitsreichen Lebens für die andere Bühne schreiben, für das Theater, um dort die Rätsel zu lösen, die mich schon seit frühester Kindheit umfangen hatten ... " (3) |
Auch hier ist sicherlich viel Interpretation aus der Sicht des 68-jährigen mit in die Erinnerungen eingeflossen, aber der Wunsch, Dramatiker zu werden, als eine Schriftstellerlaufbahn realisierbar erschien (wenn auch der Zeitpunkt dieses Entschlusses um einige Jahre später anzusetzen sein wird), ist durchaus glaubhaft. Die Theaterleidenschaft Karl Mays hielt bis ins Alter vor. Hansotto Hatzig, dem Einsicht in das Archiv des Bamberger Karl-May-Verlages gestattet worden war, schreibt:
| "Wie aus Klara Mays Tagebuch hervorgeht, sah May allein in den Jahren 1902-10 an den Dresdener Theatern das ganze klassische Repertoire, teils mit den größten Interpreten der damaligen Zeit ... Neben Goethe, Kleist, Lessing, Schiller, Shakespeare und Hebbel sahen die Mays aber auch 'erschüttert' und 'tief bewegt' Hugo von Hofmannsthal und Gerhart Hauptmann." (4) |
Aber nicht nur Jugend- und Kulturerlebnisse bestimmten Karl Mays Verhältnis zum Theater. Sein ganzer Stil ist "dramatisch". Die Romane Mays werden
| 1) | Karl May: 'Mein Leben und Streben' - Freiburg - 1910 - (Reprint der Erstausgabe: Hildesheim/New York - 1975) - S. 55-57 |
| 2) | ebda - S. 63 |
| 3) | ebda - S. 110 f |
| 4) | Hansotto Hatzig: 'Karl May und Sascha Schneider' - Bamberg - 1967 - (Beiträge zur Karl-May-Forschung Bd 2) - S. 233 |
nicht durch die Schilderungen der fremden Landschaften und Menschen geprägt sondern durch Dialoge und Gespräche. Durch sie wird die Handlung vorangetrieben, werden die Handelnden charakterisiert, und der Zusammenfluß von Erzählzeit und erzählter Zeit im Dialog ist sicher eines der wichtigsten Stilmittel, mit denen May Spannung erzeugt. So wurde die emotionale Bindung Mays ans Theater unterstützt durch eine Begabung für dialogische Darstellung:
| "Ein Handlungsablauf lebt bei May vom Dialog. Hier ist die Steifheit, die in den beschreibenden Partien oftmals aufkommt, sprachlicher Lockerheit gewichen, weil die Fesseln des in Dialekt aufgewachsenen, aber nach sprachlichem Glanz strebenden Schriftstellers abgestreift sind und er seinen Gestalten im Dialog quasi Leben einhaucht." (5) |
Für die Gestaltung eines Dramas fehlte ihm jedoch zunächst die Fähigkeit (und wohl auch die Zeit) zur Arbeit an Sprache und Form:
| "Die Wahrheit ist, daß ich auf meinen Stil nicht im Geringsten achte. Ich schreibe nieder, was mir aus der Seele kommt, und ich schreibe es so nieder, wie ich es in mir klingen höre. Ich verändere nie, und ich feile nie ... Auch befleißige ich mich keiner sogenannten künstlerischen Form." (6) |
Erst das Spätwerk zeigt ein Bemühen um Form- und Sprachgestaltung; erst nach 'Am Jenseits', dem "formal wohl gelungensten Roman Mays" (Wollschläger), und den Schlußbänden des 'Silberlöwen' mit ihrer rhythmischen Prosa war Karl May reif für sein Drama.
2. " V o r s t u d i e n , Ü b u n g e n u n d S k i z z e n "
An keinem Werk hat Karl May so lange gearbeitet, wie an seinem Drama. Das ganze Jahr 1905 verging über die Erstellung einer Erstfassung, die von May dann aber verworfen wurde; am 13.1.06 schrieb er an Sascha Schneider:
| "... meine Arbeit schreitet gut vorwärts. Nicht auf dem Papier. Denn alles, was fertig war, habe ich soeben wieder weggeworfen. Es wäre ein guten Drama geworden, vielleicht ein sehr gutes, aber ein Kunstwerk - - - NICHT!" (7) |
Die Vorarbeiten zu 'Babel und Bibel' lassen sich bis in das Jahr 1904 zurückverfolgen. Das Werk sollte zunächst nach der Hauptfigur 'Abu Kital' heißen; der neue Titel 'Babel und Bibel' geht zurück auf den damals großes Aufsehen in der Öffentlichkeit erregenden Babel-Bibel-Streit, der wohl auch äußerer Anstoß für Mays Dramenkonzeption war. Es ging beim Babel-Bibel-Streit um vom Assyrologen Friedrich Delitzsch in Vorträgen und Aufsätzen (1902-1905) veröffentlichte Forschungsergebnisse vorderasiatischer, archäologischer Ausgrabungen, die die Abhängigkeit mehrerer Stellen des Alten Testamentes von assyrisch-sumerischen Texten nachwiesen. Ins Blickfeld und ins Kreuzfeuer der öffentlichen Meinung geriet diese - auch damals eigentlich gar nicht so neue - Enthüllung dadurch, daß Kaiser Wilhelm Il. einem der Vorträge Delitzschs beiwohnte und sich negativ dazu äußerte.
| 5) | Ekkehard Koch: 'Anmerkungen zu Mays Stil: Der Dialog' - in Mitteilungen der Karl-May-Gesellschaft Nr. 8/Juli 1971 - S. 7 |
| 6) | Karl May: 'Mein Leben und Streben' - (Reprint) - a.a.0. - S. 228 |
| 7) | zitiert nach: Hansotto Hatzig: 'Karl May und Sascha Schneider', S.102. Das Manuskript der Erstfassung wird (unvollständig) im Archiv des KM-Verlags unter Verschluß gehalten. Bisher war es nur Hansotto Hatzig (für o.a. Monographie) erlaubt, daraus zu zitieren (S. 137 u. 149). Ein Ausschnitt als Faksimile im Graff-Anzeiger Nr. 10 (S. 29-31).- Im Ohre behalten sollte man vielleicht die befremdliche Unterscheidung Mays zwischen einem Kunstwerk und einem sehr guten Drama. |
Auch Karl May besuchte einen Vortrag Delitzschs:
| "Tagebuch Klara May: 'Sonnabend, d. 31.1. (1903). Vortrag v. Prof. Delitzsch Über 'Babel und Bibel'. - Der Vortrag war uns besonders interessant dadurch, daß er wie ein Referat aus Karls Büchern klang. (8) ... Karl will sich Delitzschs Werke kaufen und selbst diese alten Sprachen studieren. ... (9) |
May kaufte nicht nur die Bücher Delitzschs; er erwarb nahezu die gesamte Literatur zum Babel-Bibel-Streit und darüber hinaus noch zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen über die altbabylonische Geschichte und deren archäologische Entdeckung. (10)
Im Karl-May-Jahrbuch 1920 veröffentlichte Dr. Max Finke ('Aus Karl Mays literarischem Nachlaß') die Notizen, die May sich während der Lektüre jener Werke machte. Einen direkten Niederschlag im Drama scheinen mir diese Notizen allerdings nicht gefunden zu haben. Ich habe einige einschlägige Werke, die sich in Mays Bibliothek befinden, durchgesehen; dabei fielen mir andere - nicht von May notierte - Passagen ins Auge, die möglicherweise die Gedankengänge Karl Mays bei der Arbeit an 'Babel und Bibel' beeinflußten:
In 'Hölle und Paradies bei den Babyloniern' (11) beschreibt Dr. Alfred Jeremias die Höllenfahrt der Göttin Istar: "... alte Totengesetze gebieten, daß aller Schmuck zurückbleibe, nackend muß der Mensch in die Totenwelt treten" (S. 7). Zuerst wird der Göttin die Krone genommen, dann werden das Geschmeide, die Kette, die Gewänder von ihr gefordert. Parallele: Entkleidung der Seele (12) und Designierung Abu Kitals (13).
Auf S. 16 stellt Dr. Jeremias die Göttin der babylonischen Unterwelt vor: Erisch KIGAL, dargestellt als löwenköpfiges Ungeheuer. Ihr Gemahl ist Nergal, der Gott des Krieges (Nergal - Der Marduk (Gott) des Kampfes), der sie bei der Brautwerbung "beim, Schopfe (ergriff), sie vom Throne herab auf die Erde (stieß), um ihr den Kopf abzuschlagen" (S. 17)- Parallele: Das Drachenstandbild KITAL, dem ja zum Schluß durch Ben Tesalah auch der Kopf abgeschlagen wird (F 202/B 246), aber auch Mays Anweisungen, den Ort des Dramas betreffend: "Die flankierenden Figuren stellen geflügelte Löwen mit Menschenköpfen dar, Sinnbilder des Kriegsgottes Nergal" (F 8 / B 100).
Weiterhin berichtet Jeremias (S. 17): "Eine vom Nergaltempel in Kutha ... ausgehende Legende nimmt an, daß die Sündflut von einem aus der Unterwelt stammenden Riesengeschlechte angestiftet worden ist." Parallele: Die ersten An'allah werden von Babel als "ein Stamm von Riesen" bezeichnet (F W-/B202).
| 8) | Anm. von mir: Diese Übereinstimmung besteht nicht nur in Bezug auf die Forschungsergebnisse, sondern vor allem in der Forderung, die Verdienste des Orients für die abendländische Kultur anzuerkennen und die überhebliche Haltung des Abendlandes dem Morgenlande gegenüber zu revidieren.- Siehe dazu auch das Gedicht 'Verbrüderung' in Karl May: GW Bd 49 'Lichte Höhen' - Bamberg - 1956 (81. Tsd) -S.446 |
| 9) | Hansotto Hatzig: 'Karl May und Sascha Schneider' - a.a.0. - S. 234 |
| 10) | Hatzig führt einige Werke an (S. 251); der schon erwähnte Dr. M. Finke ebenfalls. Ich verweise besonders auf die Seiten 246-248 und 254-256 des KMJB 1931 (Verzeichnis der May-Bibliothek). |
| 11) | Enthalten in 'Der Alte Orient' - Jg 1 - Leipzig - 1900 |
| 12) | Karl Mays 'Babel und Bibel' - Freiburg - 1906 - S. 117 f u. 129 f. Vgl. Karl May: GW Bd 49 'Lichte Höhen' - a.a.0. - S. 184 u. 193. Im folgenden werden den 'Babel-Bibel'-Zitaten die Seitenangaben nachgestellt: F - Freiburg / B - Bamberg |
| 13) | "Herunter mit dem Mantel von Elissa" (F 150 / B 209) "Herunter mit dem Reif von Eridu" (F 154 / B 212) "Nun auch herunter mit der Suri-Klinge" (F 159 / B 217) Auch schon F 129 / B 193 |
Aufgegriffen hat May wohl den bei Jeremias auftauchenden Ausdruck "von Eridu". Bei den Babyloniern war's aber kein "Reif von Eridu" sondern "ein Priester in Linnen von Eridu gehüllt" (14).
Die für den Schnell- und Vielschreiber May sehr lange Zeit der Werkentstehung erklärt sich aber nicht nur aus den umfangreichen Vorbereitungen, sondern hat ihre Ursache gleichfalls in den enormen Belastungen, denen May in der Zeit von 1903 bis 1907 durch die Prozesse um die Kolportage-Romane, durch seine Scheidung und durch die ständigen Anfeindungen der Presse mit den daraus erwachsenden Gerichtsterminen wegen Beleidigung und Verleumdung ausgesetzt war. Während May an seinem Drama arbeitete, fielen die Hammerschläge der Schmiede unaufhörlich auf ihn nieder: Dem Aviatiker May wurden die Flügel schon vor dem Start allzusehr gestutzt.
2.2. Skizzen - Das Vorspiel-Fragment
Im KMJB 1920 veröffentlichte Dr. Max Finke auf den Seiten 58-61 Handschriftliches aus dem Nachlaß Mays mit der Überschrift
| "Babel und Bibel. (Plan.) Ein dramatisches Vorspiel aus zwei Welten." |
und dem Schlußdatum "Montag, den 1.10.1906". Dr. Finke dazu: "Man darf annehmen, daß May dieses Vorspiel nach seiner Vollendung einer 2. Auflage von 'Babel und Bibel' oder der eigentlichen Aufführung zugedacht hat" (S. 57). Bei Hansotto Hatzig (S. 137 f) findet sich ein Auszug. Das Fragment bildet ein recht wirres Konglomerat aus Szenenbruchstücken, Satzfragmenten und Anmerkungen zu literarischen Studien. Schon das Personal, das May verwenden wollte, macht stutzig: Neben Kara Ben Halef, Ard, dem Herrn der Erde, und dem Scheik der Dschesireh-Araber führt er ZWEIMAL Marah Durimeh auf: als Herrin von Kulub und als Menschheitsseele. Im Fragment selber wird zwischen beiden jedoch nicht ausdrücklich unterschieden. Vielleicht deutet sich hier die im Stück getroffene Unterscheidung von alter Menschheitsseele (Marah Durimeh) und neuer Menschheitsseele (Bent'ullah) an.
Einige Szenenteile lassen sich als Vorstudien zu im Drama Ausgeführtem deuten:
| a) | "Scheik. Wie, wenn nun Gott die Poesie uns sendete, uns aufzuklären über ... Kein Mensch würde ihr glauben. So glaube ich dir auch nicht. Du bist Poet, und Poeten sind Phantasten. Als die Poesie verschwunden war, trat die Verwirrung ein. Vorsitzender empfiehlt strengste Prosa, Wissenschaftlichkeit, Objektivität. Strengster Ausschluß der Phantasie" (S. 59). (15) |
| Parallele: | "Der Kadi hat zu sprechen - - - OHNE Märchen! | (F 33 / B 121) |
| "Was weißt denn Du von Marah Durimeh!" | (F 35 / B 123) |
| b) | "Wir spielen nicht, was wir uns selbst ersinnen; Wir spielen das, was uns das Leben gibt. Wir spielen euch das nach, was ihr uns vorgespielt" (S. 60) und "Kara: 'Schattenbilder? Die sollt ihr haben. Doch wer den Schatten |
| 14) | In anderen Werken Jeremias', Hommels und Hilprechts habe ich nichts mehr gefunden. Aus Dr. Fritz Hommel: 'Geschichte Babyloniens und Assyriens' - Berlin - 1885 - S. 104 - entnahm ich das Titelbild dieser Arbeit: 'Thoreingang zu Dur-Sargon in Khorsabad (nach Places Rekonstruktion)', das als Bühnenhintergrund für 'Babel und Bibel' meiner Meinung nach gut geeignet wäre. (May besaß den Hommel). |
| 15) | Die den Zitaten nachgestellten Seitenangaben beziehen sich auf das KMJB 1920. Die Auslassungen (...) sind auch im Original so zu finden. |
| sehen will, der hat das Licht mit in den Kauf zu nehmen. Wir zeigen euch also zuerst ... '" (s. 61). |
| Parallele: | Schattenspielerszene Phantasie: "Ich heiße stets wie der, dem ich mich füge" (F 120 / B 185). |
| c) | "Der Duft, der über diesem Stücke ruhen soll: Der Scheik haßt das Abendland. Und Marah Durimeh: Der Geist ging von euch fort, nach Westen. Ich ging ihm nach, ihn euch zurückzuholen, den Menschengeist. Er stand im Abendrot. Er kehrte um und kam mir entgegen, hochgestaltet und leuchtenden Angesichts" (S. 61). |
| Parallele: | "Scheik der Todeskarawane: Der 'Geist des Morgenlandes' ging nach West / ... / Und nun er in die Heimat wiederkehrt" (F 196 / B 241 f). |
Die gerade angeführten Teile halte ich für Vorstudien zum Drama - nicht zum Vorspiel. Dem Vorspiel werden wohl die mythischen Szenen mit Ard, dem Herrn der Erde, zuzuordnen sein. Die Ard-Texte erinnern allerdings auch stark an das Kyros-Fragment (16). Eine plausible Anordnung der Bruchstücke des Vorspiele sähe meines Erachtens so aus:
| 1. | Monolog des Herrn der Erde: |
| "Man schlief Jahrhunderte lang. Man wachte nur für Augenblicke auf, wenn kämpfende Gebirge einander anbrüllten oder Ozeane in wilden Träumen schnarchten. Kam mir ein Mastodon quer über die Nase gelaufen oder eine Urweltechse in das Ohr gekrochen, ich fühlte es nicht, das winzige Ungeziefer. Heut aber irritiert mich jeder Menschenfloh. Man schläft überhaupt nicht mehr; man ist nervös geworden. Jetzt ackert mir die Menschheit übers Lager und pflanzt mir Zuckerrüben, Kartoffeln oder Gerste in das Bett. Und gar die Decke, wie hat man die zerrodet! Der schöne Filz ist hin. Und was noch übrig ist, das stinkt nach Latrinenjauche und Agrikultur. Lege ich mich trotzdem hin, so spieße ich mir einen Kirchturm in das Fleisch oder es rattert ein Schnellzug unter mir hin. Das halte der Teufel aus, nicht aber ich! Steine, Pflanzen, Tiere, die können nichts verraten. Die lasse ich noch gelten. Aber die Menschen! Die denken nach, die stecken ihre Nase in alles. Sobald ein Mensch mir hier in diese Bude kommt, bin ich verloren. Das ist eine alte Prophezeiung" (S. 61). | |
| 2. | Dialog: Ard - Kara Ben Halef |
| "Ard: Was ist der Mensch? Kara: Der Mensch ist eine Monarchie, regiert vom Geist. Ard: Verdammt, das weiß der Kerl! Wo aber bleibt die Seele? Kara: Sie ist die Sultana ... Und alles, was sich tiefer unten regt ... Ard: Das ist der Plebs, der ... Kara: Das ist das Volk, auf dessen starken Schultern der Thron des Herrschers ruht" (17). |
Der Dialog müßte nun den Unterschied zwischen Edelmensch und Gewaltmensch berühren. Ard kennt nur Gewaltmenschen, und denen will er nicht dienen:
| "Ard ist dem Menschengeiste tributpflichtig. Will sich aber freimachen." (S. 61) |
Kara verteidigt den Menschen unter Hinweis auf den kommenden Edelmenschen.
| 3. | Kampf zwischen Ard und Kara Ben Halef |
| 16) | Vgl. Karl May: 'Kyros' in GW Bd 49: 'Lichte Höhen' - a.a.0. - S. 300 f -.Wichtig hierzu vielleicht das Bild 'Herr der Erde' von Sascha Schneider - siehe S.19 dieser Arbeit. |
| 17) | Hansotto Hatzig: 'Karl May und Sascha Schneider' - a.a.0. - s. 137 f (KMJB 1921 - S. 60) |
| 4. | Marah Durimeh greift ein |
| "Beim letzten Kampf um Kara erscheint Marah Durimeh, stellt sich zwischen (sie!) und ruft Ard zu: | |
| Dein ist die Erde, aber nicht der Mensch. Ich bin der Mensch, der nach der Wahrheit sucht Und nach dem Ort, an dem ich ihr begegne. Im Paradies hat mich der Herr verflucht, Daß er mich hier nun in der Hölle segnel" (S. 59 f) (18) | |
| 5. | Schlußwort - Überleitung zum Drama |
| "Heut ist der Tag der tausend Seligkeiten, Der große Tag, den unser Herr gemacht. So laßt uns denn zur Erde niederschreiten. Es werde Licht - - - (Glocken klingen) Der Mensch ist aufgewacht!" (S. 59) (19) |
3. H e r a u s g a b e u n d A u f n a h m e
May versprach sich viel von seinem Drama. Er bereitete die Herausgabe sorgfältig vor. So kündigte er das Stück bereits im Februar 1906 (in der gedruckten Danksagung 'An meine Gratulanten' anläßlich seines Geburtstages) an und leitete der Presse Waschzettel und Einführungen zu (er schrieb z.B. umfangreiche Erläuterungen zu 'Babel und Bibel' für A. Abels, den Redakteur der Münchener Neuesten Nachrichten (20). Erfolg war diesen Bemühungen jedoch nur bedingt beschieden. Einige wenige Rezensionen behandelten das Drama recht wohlwollend, aber der weitaus größte Teil der Presse (und alle Bühnen) ignorierte das Stück oder bezeichnete es als "elenden Machwerk". Auch Mays Versuch, das Drama per Protektion auf eine Bühne zu bringen (am 25.9.06 schrieb er einen entsprechenden Brief an die Prinzessin Ludwig von Bayern, die als May-Verehrerin bekannt war)(21) scheiterte.
Die erwartungsfrohe Haltung dem Werk gegenüber mußte resignativer Hoffnung auf die Zukunft weichen:
| "Es müßte über die Bretter, die die Welt bedeuten, erst der schwere Schneepflug gehen, bevor man sagen könnte, daß für solche Stücke die Bahn vorhanden sei; wenn ich trotzdem grad ein solches Stück geschrieben habe, für das noch keine Bahn vorhanden ist, so antworte ich getrost und zuversichtlich: NUR DARUM, DAß ES EBEN SCHNEEPFLUG WERDEN MÖGE!" (22) |
| 18) | Unter diesem Textstück steht die Anmerkung: "(Kam in der Schweizermühle 9./10.8.05)" |
| 19) | Dieser Versuch, aus den Vorspielfragmenten eine plausible Szenenfolge herauszukristallisieren, stimmt in weiten Zügen mit Hansotto Hatzigs Version überein.- Kurze Textstücke, Satzfragmente etc., die mir Notizcharakter zu haben scheinen und noch keinen Sinn ergeben, habe ich ausgelassen; ebenfalls unberücksichtigt blieben die Literaturanmerkungen (S.60). Einen seltsamen Text Ards konnte ich nicht verwenden: "Erde: So hört: Den Raumes Seele ist die Zeit, Und stirbt der Raum, wird sie zur Ewigkeit. Drum ist hier jedermann darauf bedacht, Daß sich die Ewigkeit bei uns nicht mausig macht, Denn, lassen wir sie nicht zu uns herein, Wird's umgekehrt: wir werden ewig sein." (S. 59) |
| 20) | Karl May: 'Skizze zu Babel und Bibel' - in KMJB 1921 - S- 41 ff Vgl. Karl May: GW Bd 49 - a.a.0. - S. 251 ff.- Abels Artikel erschien am 18.11.,1906 (Wiederabdruck: Graff-Anzeiger Nr. 10). |
| 21) | Vgl. Hans Wollschläger 'Karl May' - Zürich - 1976 - S. 140 |
| 22) | Karl May: 'Skizze zu Babel und Bibel' - a.a.0. - s. 55 GW Bd 49 - a.a.0. S. 262 |
Knapp vier Jahre später heißt es dann in 'Mein Leben und Streben' nur noch:
| "Ich habe ein einziges Mal etwas Künstlerisches schreiben wollen, mein 'Babel und Bibel'. Was war die Folge? Es ist als 'elendes Machwerk' bezeichnet und derart mit Spott und Hohn überschüttet worden, als ob es von einem Harlekin oder Affen verfasst worden sei. Da weicht man zurück und wartet auf seine Zeit. Und diese kommt gewiß." (23) |
4. U n t e r s u c h u n g d e s D r a m a s
Schauplatz des Dramas ist der Vorplatz des Turms von Babylon. Dort wartet der Scheik der An'allah, Abu Kital, auf Marah Durimeh, die Verbündete des feindlichen Stammes der Kiram. Abu Kital hat sie zum Schachwettkampf herausgefordert. Das Schachspiel ist jedoch nur als Vorwand gedacht; es soll die Führungsspitze des feindlichen Stammes in eine Falle locken. Mit Hilfe verbündeter Stämme wollen die An'allah die Kiram, die europäischem und christlichem Einflusse unterliegen, besiegen, um dem Islam im Morgenlande wieder die gehörige Achtung zu verschaffen: "Das Morgenland nur für das Morgenland!" (F 24 / B 113)
Unterstützung für seine Pläne findet der Scheik bei den Vertretern von Recht (Kadi) und Religion (Imam); nur der alte Märchenerzähler (Hakawati) spricht sich gegen eine kriegerische Auseinandersetzung aus, da er aus einer alten Sage weiß, daß die zugespitzte Konfrontation von Abendland und Morgenland auf der Unkenntnis alter Begebenheiten beruht ("Der wahre Geist der Bibel aber schmachtet / ... / Und niemand hat den Mut, ihn zu befreien." F 31 / B 119). Vor allem aber ist für die feindliche Gesinnung der An'allah persönliches Machtstreben von Imam, Kadi und Abu Kital verantwortlich. "Das Morgenland nur für die An'allah!" (F 51/B 135)
Der Plan des Scheiks sieht vor, die geladenen Gäste zu Kampfhandlungen zu provozieren, um sie - ohne das heilige Gastrecht zu verletzen - überwältigen zu können. Die Provokation soll durch den Scheik der Todeskarawane und seine Männer bewerkstelligt werden: Das Schachspiel findet auf freiem Feld mit Menschen als Figuren statt. Marah Durimeh - so vermutet Abu Kital - wird dazu die Vornehmen der Kiram aufbieten, denen die An'allah die zerlumpten, verachteten Männer der Todeskarawane entgegenstellen werden. Auf diese unerhörte Beleidigung können die Kiram nur mit den Waffen antworten.
Der zum Frieden mahnende Hakawati muß zwar der Übermacht der Kampfbegeisterten weichen doch plant er einen Gegenschlag: Er bietet an, seine berühmte Freundin, die Phantasie, zu bitten, das als Unterhaltung für die Gäste geplante Schattenspiel zu betreuen. Sein Vorschlag wird freudig begrüßt, und Schefaka, die Tochter des bei den An'allah weilenden Forschers Babel und Vertraute des Märchenerzählers, bringt kurze Zeit später die Nachricht, daß die Phantasie zugesagt habe.
Nach der aufregenden Versammlung läßt Abu Kital sich von Schefaka verwöhnen und von Babel unterhalten: Dabei werden in ihm Erinnerungen an vergangene, friedvollere Tage erweckt: Der Scheik war nicht immer nur der Gewalt, dem Kampfe ergeben; seine Frau Bent'ullah, eine Christin, zog durch ihre Güte und wahre Frömmigkeit ihn und den ganzen Stamm in ihren Bann. Ihr Einfluß wurde aber dem Kadi und dem Imam zu groß, und beide beseitigten sie, indem sie Bent'ullah mit ihrem kleinen Sohn hinterrücks in der Wüste aussetzten und dem Scheik eine fingierte Todesurkunde vorlegten.
Die Erinnerung an die Totgeglaubte wird übermächtig, als Schefaka in Gewand und Schmuck der Bent'ullah - angelegt auf Geheiß Abu Kitals - vor den Scheik erscheint. Diese Szene wird abrupt durch den Auftritt des
| 23) | Karl Mays 'Mein Leben und Streben' - (Reprint) - a.a.0. - S. 229 |
Scheiks der Todeskarawane unterbrochen. Die herablassende Begrüßung durch Abu Kital fordert den Stolz des fremden Scheiks heraus, der nun im Gegenzug mit der Erzählung von der Geisterschmiede zu Märdistan den Anspruch Abu Kitals, 'Geist des Morgenlandes, zu sein, erschüttert; denn nur, wer in dieser Prüfstätte durch Schmerz und Qual von allen irdischen Gebrechen geläutert wurde, ist des Titels "Geist" würdig.
Zweifach ist der Plan Abu Kitals jetzt schon geschwächt: Durch die Erinnerung an die geliebte Christin wurde der lodernde Haß auf die edlen Kiram gemildert, und die Erzählung von der Geisterschmiede hat die Frage aufgeworfen, ob der Scheik der An'allah überhaupt die erforderlichen Qualitäten zum Vertreter des Morgenlandes besitzt. Eine weitere Stütze des Plans - die Kumpanei mit Recht und Religion - fällt durch das angekündigte Schattenspiel: Die Phantasie inszeniert ein Spiel, in dem die verbrecherische Intrige von Kadi und Imam enthüllt wird. Der Scheik erfährt, daß Frau und Sohn ausgesetzt wurden und möglicherweise sogar noch leben.
Kurz nur kann die Nachricht vom plangemäßen Handeln der verbündeten Scheiks die alte Kampfeslust in Abu Kital erneut entfachen; der Gedanke an die Totgeglaubten ist stärker:
| "Bent'ullah! | ||
| Du glaubst an Einen, der dir höher steht, Als der Islam und alle Paradiese. Bei dir find ich das Glück, das Himmelreich, Und hier den Ruhm, die Herrlichkeit der Erde. Was soll ich tun? Was soll ich wählen' Sag!" | ||
| (F 103 / B 174) | (Ende des ersten Aktes) |
Die Zweifel halten jedoch nicht lange vor, die Unsicherheit ist schnell überwunden: Abu Kital empfängt die Scheiks der acht befreundeten Stämme zu einer letzten Lagebesprechung für den geplanten Kriegszug. Der Imam (24) wertet den bevorstehenden Feldzug durch sophistische Auslegung der Religionsgeschichte zum 'Heiligen Krieg' auf:
| "Für s i e (25) das ganze, ganze Himmelreich Mit Allem, was da oben strahlt und schimmert; Für u n s sei nur die winzig kleine Erde, Die jeder Christ als Jammertal bezeichnet" (F 139 / B 200) |
Die durch den Imam entfachte patriotische Begeisterung wird weiter geschürt durch den Geschichtsforscher Babel, der auf die ruhmvolle Geschichte der Völker Babylons verweist und die anwesenden Beduinen auffordert, das Erbe ihrer Vorväter anzutreten und ein Weltreich zu schaffen: ein Weltreich des Islam.
Die allgemeine Hochstimmung schlägt aber sehr plötzlich in ihr Gegenteil um: In ihrer übergroßen Erregung verraten die An'allah ihre wahren Absichten. Statt der Parole "Das Morgenland nur für das Morgenland" jubeln sie "Das Morgenland nur für die An'allah". Die verbündeten Scheike sind brüskiert, sie wittern Verrat und verlassen den Beratungsplatz.
Der Verbündeten beraubt und auch von den wetterwendischen Vertretern des Rechts und der Religion, die nur den erfolgreichen Mächtigen unterstützen,
| 24) | Imam und Kadi werden wegen ihres Verbrechens nur privat, nicht aber öffentlich zur Rechenschaft gezogen. In der Urfassung hatte Karl May eine Szene gestaltet, in der Abu Kital Imam und Kadi zur Rechenschaft ziehen will. Beide geben die Tat zu, beteuern jedoch, nur das Wohl des Stammes im Auge gehabt zu haben, versichern den Scheik ihrer unverbrüchlichen Treue und lenken seine Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Versammlung. |
| 25) | sie = die Christenheit |
im Stich gelassen, ist Abu Kital nur noch auf die Autorität seines Amtes und die Macht seiner Persönlichkeit angewiesen. Doch auch diese verliert er: Nach einem Gewaltakt gegen den Vorbeter entreißt ihm der Scheik der Todeskarawane die Herrschaftsinsignie, die Peitsche, und in dem darauf folgenden Duell wird Abu Kital endgültig besiegt. Und nicht nur der Scheik der An'allah, alle an dem "großen Plan" Beteiligten werden (durch eine List der Kiram) besiegt und gefangengenommen.
Nachdem Abu Kital aller äußeren Macht entkleidet worden ist, muß er noch von seiner inneren Verblendung befreit werden. Der Scheik der Todeskarawane, der sich nun als Ben Tesalah, Scheik der Kiram, zu erkennen gibt, kündigt an, wie die Läuterung vor sich gehen wird:
| "Zunächst muß ich dich zur Erkenntnis bringen, Daß es mit dir zum raschen Ende geht. Und dann? |
| Zur Einsicht deiner Niedertracht. |
| Und dann? |
| Zum Eingeständnis deiner Schuld. |
| Und dann? |
| Den 'Geist der Bibel' freizugeben. |
| Und dann? |
| Und dann hast du dich SELBST besiegt |
| Und bist es wert, nach Märdistan zu gehen." (F 184 / B 233) |
Abu Kital erklärt sich mit allem einverstanden; daraufhin fallen die Masken: Als Phantasie hat Marah Durimeh in die Geschehnisse eingegriffen, und in Bent'ullah und Ben Tesalah findet der Scheik Frau und Erben wieder. Freiwillig begibt er sich nach Märdistan, um in der Geisterschmiede geläutert zu werden. (Ende des Stückes)
Für die äußere Handlung des Dramas hat May sich nichts Neues einfallen lassen; sie setzt sich aus Elementen seiner früheren Abenteuerhandlungen zusammen:
Handlungsstrang: "Kriegsplan": Ein Lauscher erhorcht den Kriegsplan seines Gegners. Dieser Plan besteht in der Konstruktion einer Falle, die dem Gegner, ist er erst hineingetappt , keine Möglichkeit zur Gegenwehr mehr läßt. Der Lauscher fängt die Boten zu den Verbündeten des Gegners ab und übernimmt selbst deren Rollen. Wenn dann die Falle zuschnappen soll, findet sich der Gegner in seiner eigenen Falle gefangen und kann leicht besiegt werden.
Das ist genau die Methode, mit der Kara Ben Nemsi und der Ustad am Schluß des "Silberlöwe IV" das Heer der Schatten besiegen. Doch auch Winnetou und Old Shatterhand haben so mehrfach ihre Feinde besiegt.
Das Motiv des 'verlorenen / geraubten Kindes', das als Jüngling oder Mann unerkannt in die Heimat zurückkehrt und dort nach zahlreichen Verwicklungen Vater und Mutter wiederfindet (Handlungsstrang "Ben Tesalah"), gehört zum Motiv-Kanon der Kolportage; ebenso das Motiv des plötzlich auftauchenden (meist ein Verbrechen aufklärenden) Scheintoten (oder Totgeglaubten): Handlungsstrang "Bent'ullah". Aber auch im "Silberlöwe IV", das dem Werk ja zeitlich näher steht, findet sich Ähnliches: Die "Agha-Sibil-Episode".
Die Personenkonstellation Vater (Gewaltmensch), Mutter (Edelmensch) und Kind (Edelmensch), bei der der Vater vom guten Beispiel der Mutter beeinflußt und vom Kind "bekehrt" wird, ist ebenfalls nicht neu: Familie Waller aus 'Und Friede auf Erden' ist Vorbild (eigentliches Vorbild ist natürlich die Familie May - doch davon später).
Hier ist nun auch der Ort, 'Babel und Bibel' auf Vorbilder im Bereich der klassischen Theaterstücke zu untersuchen. Parallelen zu Hofmannsthal oder Gerhart Hauptmann (vgl. S. 4) konnte ich nicht feststellen. Vielleicht sind die mythischen Passagen des Vorspiele durch Gerhart Hauptmanns
'Versunkene Glocke' angeregt worden (Mays sahen das Stück am 27.5.02 (26), den Text besaß Karl May ebenfalls: Ausgabe Berlin - 1899).
Recht eindeutig lassen sich verwandtschaftliche Bezüge zu Shakespeares 'Hamlet' feststellen: Schauspielerszene im 'Hamlet' und Schattenspielerszene in 'Babel und Bibel' sind in Aufbau und Punktion recht ähnlich. Ob man im weitesten Sinne eine Verbindung ziehen kann zwischen der Verkleidung Ben Tesalahs als Scheik der Todeskarawane und der "Verkleidung" Hamlets als Wahnsinniger, will ich offen lassen. Überhaupt halte ich es nicht für gerechtfertigt, Mays Stück nun mit Gewalt aller Eigenständigkeiten berauben zu wollen. Daß May eine besondere Affinität für den 'Hamlet' besaß, zeigt sich daran, daß in seiner Bibliothek auffallend viel Erläuterungen zu gerade diesem Stück zu finden sind. Außerdem wurde in den damals gerade aktuellen "Dramatischen Handwerkslehren", an denen May sich orientierte, (er besaß die einschlägigen Werke von Avonianus (ps. R. Hessen), R. Franz, G. Freytag, A. Nossig, R. Prölß), der 'Hamlet' immer wieder als besonders geglücktes Drama vorgeführt und analysiert. Gesehen haben Mays den 'Hamlet, mehrfach: Am 23.3.02: "Karl war ... stark eingenommen von der Wucht der Vorführung" und am 21.4.02 (26). Später (zur Zeit der Entstehung von 'Babel und Bibel') besuchten Mays kaum noch das Theater; die stärksten Eindrücke der "theaterintensiven" Zeit (1902-04) - zu denen eben auch 'Hamlet' gehörte - werden aber wohl haften geblieben sein. Mays Hamlet-Begeisterung hat gewiß Gründe, die in seiner psychischen Konstitution zu finden sind: Im 'Hamlet' geht es ja um eine vom Vater dem Sohne auferlegte schwere Aufgabe, der der Sohn nicht gewachsen ist; um eine Mutter, die einen dem Sohne nicht genehmen Geliebten (Mann) hat. Hierzu verweise ich auf Wollschlägers 'Materialien zu einer Charakteranalyse Karl Mays' in den Jahrbüchern der KMG.
Um die Anlehnungs- / Entlehnungsthematik nicht noch einmal aufnehmen zu müssen, sei hier schon ein Motiv, das eigentlich der "symbolischen Handlung" angehört, hinsichtlich seiner Herkunft behandelt: Hansotto Hatzig weist darauf hin, daß May das Motiv der Geisterschmiede zu Märdistan nicht einem dem eigenen Werk entstammenden Vorbild entnahm oder gar neu schuf: Otto Julius Bierbaums (1865-1910) Gedicht 'Schmied Schmerz' scheint hier Pate gestanden zu haben. Karl May besaß dieses Gedicht: In dem in seiner Bibliothek stehenden 'Türmer-Jahrbuch 1905' ist es auf der Seite 362 zu finden. Das dort ebenfalls abgedruckte Bierbaum-Gedicht 'Sei getrost' wird Karl May sicher gleichfalls stark berührt haben, da es inhaltlich auch von ihm hätte stammen können:
| Schmied Schmerz | ||
| Der Schmerz ist ein Schmied. Sein Hammer ist hart, Von fliegenden Flammen Ist heiß sein Herd; Seinen Blasebalg bläht Ein stoßender Sturm Von wilden Gewalten. Er hämmert die Herzen Und schweißt sie mit schweren Und harten Hieben In festem Gefüge. Gut, gut schmiedet der Schmerz. Kein Sturm zerstört, Kein Frost zerfrißt, Kein Rost zerreißt, Was der Schmerz geschmiedet. |
| 26) | Mitteilungen von Hansotto Hatzig An 'Hamlet' erinnert auch das Gedicht 'Der Totengräber' in Karl May: GW Bd 49 'Lichte Höhen' - a.a.0. - S. 435 f. |
| Sei getrost! | ||
| Das ist die Sünde, die du fliehen sollst: Der Hader mit dem Schicksal. Sei getrost! Es führt dich gut, geht es auch dunklen Weg. Folg nur ergebnen Herzens wie ein Kind, Das an der Mutter Hand im tiefen Wald Nach Hause strebt und innig sicher ist; Die Mutter, o die Mutter kennt den Weg. |
4.1.2. Die innere (symbolische) Handlung
Wichtiger als die äußere Handlung ist die symbolische Handlung eines Stückes, da sie die eigentliche Aussage enthält: "In der Handlung wird um äußere Ziele, Güter und Erfolge gestritten, im Vorgang wird um die Klärung bedeutsamer menschlicher Werte und um die Behauptung großer Werthaltungen gerungen" (27). Worum es Karl May in 'Babel und Bibel' eigentlich geht, hat er selbst in seiner 'Skizze zu Babel und Bibel' angegeben: Es soll gezeigt werden, "daß sich der Gewaltmensch in den.Edelmenschen zu verwandeln habe, und daß dies nur auf dem Wege der Gottes- und der Nächstenliebe, den Christus lehrte, geschehen könne" (28).
In diesem Kapitel soll nachgezeichnet werden, wie sich Mays Anliegen durch die äußere Handlung hindurch dem Publikum vermittelt. Daß hierbei die Erläuterungen Mays und die Namenserklärungen außer acht bleiben müssen (soweit sie nicht im Text selber erfolgen) (29), versteht sich, da dem Zuschauer auch nur das zur Verfügung steht, was ihm die Bühne direkt bietet. Es versteht sich ebenso, daß die speziellen Regieanweisungen nicht voll berücksichtigt werden können, weil sie bei Inszenierungen jeweils verschieden realisiert werden. Ich werde die Regieanweisungen Mays nur insoweit mit zur Deutung heranziehen, als sie von einer Inszenierung unbedingt beachtet werden müssen (wenn das Drama nicht verfremdet werden soll).
4.1.2.2. Die symbolische Handlung
Am Turm zu Babel - als biblischer Ort Symbol für Gewalt, Prunk und Verderbnis; als Trümmerhaufen Symbol für die Vergänglichkeit irdischen Machtstrebens und als Gegenstand archäologischen Interesses Symbol für altes, unterschwellig bis ins Gegenwärtige fortwirkendes Kulturgut -, im Schatten dieses eindrucksvollen Monuments versammeln sich arabische Beduinen, die - heute genauso wie zu Mays Zeiten - im Bewußtsein von Mitteleuropäern als heißblütig, gewalttätig, fanatisch-religiös und verschlagen vorgestellt werden. Solche Gewaltmenschen lassen sich leicht von ihrem Anführer mit dem sprechenden Namen "Vater des Kampfes" - zumal wenn er von Religion und "heiligem" Recht unterstützt wird - für einen Kriegsplan gewinnen.
| 27) | Rudolf Petsch: 'Wesen und Formen des Dramas' - Bd 1 - S. 112 zitiert nach Adolf Beiss: 'Nexus und Motive' in Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte - Jg 36 (1962) S. 253.- Handlung=äußere Handlung / Vorgang = innere Handlung |
| 28) | Karl May: Skizze zu 'Babel und Bibel' - a.a.0. - S. 52; vgl. GW Bd 49 'Lichte Höhen' - a.a.0. - S. 260 |
| 29) | Daß ich nicht zu gänzlich anderen Deutungen komme als May, liegt erstens daran, daß ich Mays Erläuterungen natürlich kenne, demnach also vorbelastet interpretiere, und zweitens selbstverständlich auch daran, daß May sehr wohl in der Lage war, seinen Gedanken poetischen Ausdruck zu verleihen. Nur die 'Feinheiten', die er hineininterpretierte, dürfen wir nicht berücksichtigen.- Im Anhang dieser Arbeit biete ich eine Vergleichslesung der Bamberger Fassung der 'Skizze' mit der Jahrbuch-1921-Fassung, so daß jeder sich selbst ein Bild der Mayschen Interpretation machen kann. |
Friedliche Tendenzen werden schon im Keime erstickt (Bent'ullah mit ihrem Sohn und der Vorbeter) oder nicht ernst genommen (Hakawati); dennoch ist der Plan der Gewaltmenschen von vornherein zum Scheitern verurteilt, da die Hauptgegnerin, die "Menschheitsseele", allgegenwärtig ist, so daß kein Plan gegen sie ausgeheckt werden kann, von dem sie nicht Kenntnis erlangte. (30)
Die Allgegenwart der Menschheitsseele steht für den Funken edler Gesinnung, der in jedem Menschen angelegt ist. Diejenigen Menschen, die gewillt sind, den beschwerlichen Weg vom Gewaltmenschen zum Edelmenschen zu gehen - oder ihn schon gegangen sind (der "Sohn des Friedens" und die Kiram) - helfen der Menschheitsseele, indem sie durch Beispiel und Tat jenen edlen Funken anzufachen versuchen. Eben diesem Zwecke - und damit gleichzeitig der Menschheitsseele - dienen auch die geistigen kulturellen Leistungen der Menschheit: Die Kunst (Phantasie (31), die Literatur (Hakawati), die Friedensreligion (Bibel) und die Wissenschaft (Babel).
Doch stehen diese kulturellen Errungenschaften auch dem Gewaltmenschen zur Verfügung. Für ihn sind sie aber nicht Hilfestellung auf dem beschwerlichen Weg vom Gewalt- zum Edelmenschen; er gebraucht sie zur Festigung und Stärkung seiner Lebenseinstellung: Gewaltreligion strebt nach irdischer Macht und stützt daher irdische Macht; "niedre" Kunst ist Zeitvertreib und lenkt von den Machenschaften der Mächtigen ab; abhängige Wissenschaft liefert den Herrschenden Ideologien und Waffen.
Da der Gewaltmensch in seinem ganzen Denken ans Irdische gebunden ist, gelingt es ihm auch dann nicht, in seinem Erkenntnisstreben zu "höheren" Einsichten vorzustoßen, wenn er sich ausdrücklich darum bemüht; er bleibt in seinen Beschreibungen am Äußerlichen hängen: Der Menschengeist ist für ihn nur in kostbaren Gewändern, edlem Schmuck, alten Waffen und Herrschaftszeichen vorstellbar (F 62 / B 143 f) und auch die "Seele" denkt er sich in Prunk und Pose (F 72 / B 150). (32)
Ohne Hilfe der Edelmenschen - als Repräsentanten der Menschheitsseele - gelingt dem Gewaltmenschen die Befreiung aus der Verklammerung mit dem Irdischen nur selten (33). Da der Gewaltmensch aber schon per definitionem
| 30) | An dieser Stelle ist ein Fehler in der Konzeption des Dramas anzumerken: Es wird zwar von der Herkunft und dem Aussehen der Menschheitsseele geredet, aber was man sich darunter vorzustellen hat (nämlich die Idee der ethischen Vollendung den Menschen oder die Verkörperung der Summe des edlen Teiles menschlichen Denkens und Trachtens) wird nicht erwähnt. Karl May dazu: "Ihre Charakterisierung würde überflüssig sein, denn die Eigenschaften der 'Menschheitsseele' verstehen sich fast ganz von selbst." ('Skizze'- a.a.0.- S. 60/ GW Bd 49 - a.a.0.- S. 265): Dem war aber sicherlich schon zu Mays Zeiten nicht so; eine kurze Szene Hakawati/Schefaka, in der Schefaka (als Verkörperung der erwachenden, ethisch orientierten Wissenschaft) nach der Menschheitsseele fragt und der Hakawati antwortet, hätte das Problem m.E. elegant gelöst (oder aber - wie ich weiter unten vorschlagen werde -: Die 1. Szene des 2. Aktes sollte an den Anfang des ganzen Stückes rücken und das Wesen der Menschheitsseele darlegen. |
| 31) | Zu der Gleichsetzung Menschheitsseele=Phantasie vgl. Sibylle Becker: 'Karl Mays Philosophie im Spätwerk' - (Materialien zur Karl-May-Forschung Bd 3)- Ubstadt - 1977 - S.14: Dort Hinweis auf "Silberlöwe III" S. 430 ff (Radebeul). |
| 32) | Zur Problematik der Geist-Seele-Beziehung bei Karl May siehe S. Becker - a.a.0. - Kapitel 'Körper', 'Anima' 'Seele' und 'Geist': S. 10-20 (besonders S. 1 8 ). |
| 33) | Ein Beispiel wird von S. Becker (a.a.O. - S.31) angeführt: Taldscha im 'Mir von Dschinnistan'. Aber auch Mary Waller ('Und Friede auf Erden') ist Beispiel hierfür. |
eine ständige Bedrohung des Edelmenschen darstellt (geistig gesehen dadurch, daß er ihn bezüglich des natürlich auch in ihm schlummernden Hanges zu irdischen Genüssen dauernd in Versuchung führt) hindert er die Edelmenschen nicht nur an der Erfüllung ihrer Aufgabe, er stellt sie auch vor die Alternative, in dauernder Verteidigungsbereitschaft den ersten Schlag zu erwarten oder versuchen zu müssen, mit von der Menschheitsseele vertretbaren Mitteln einen "Präventivschlag" zu führen. Zu den dem Wesen der Menschheitsseele nicht widersprechenden Kampfesmitteln gehört die List, mit deren Hilfe Blutvergießen vermieden werden kann (Old Shatterhand, Winnetou und Kara Ben Nemsi haben's oft genug vorexerziert - die Kiram unter Ben Tesalah führen's im Stück vor).
Kriegslist sollte aber für den Edelmenschen nur letztes Mittel im Kampfe gegen den Gewaltmenschen sein: Seine Pflicht ist es, zunächst zu versuchen, den Gewaltmenschen durch geistige Waffen zu bekehren. Als erstes gilt es, das Selbstverständnis des Gewaltmenschen zu erschüttern. Da er glaubt, in seinem Denken und Handeln den "Menschengeist" (die dem Wesen des Menschen entsprechende Lebens- und Denkungsart) zu repräsentieren, muß ihm die Überheblichkeit und Anmaßung dieses Gedankens vorgehalten werden: Nur wer in langer, schwerer Prüfung durch Schmerz und Leid sein subjektives Ich, seinen Haß, seinen Neid, seine "niederen" Gefühle überwunden hat, nur dem steht es zu, als Sprecher der Menschheit aufzutreten.
Das Selbstverständnis des Gewaltmenschen wird gestützt durch die Struktur der Gesellschaft, in der er lebt. Die Stützen dieser Gesellschaft sind "Gewaltrecht" und "Gewaltreligion". Zweifel an der Allgemeingültigkeit seines Denkens werden im Gewaltmenschen also auch durch das Auftreten "unheiliger" Machenschaften des "heiligen" Rechts und der "heiligen" Religion geweckt.
Solcherart verunsichert, haltlos und ratlos sucht der Gewaltmensch eine andere "höhere" Instanz als Halt: er betet. Doch nicht das Gebet als Ruhm und Preis des Gewaltgottes sondern das vertrauend um Hilfe bittende Gebet an einen gütigen Vatergott drängt sich ihm intuitiv auf die Lippen: Der edle Funken dringt durch die Bruchstellen des alten Weltbildes ans Licht.
Die Bestürzung des Gewaltmenschen hält indes nicht lange vor. Die Verstrickungen der Realität sind zu stark, er widmet sich seinen ursprünglichen Plänen, sobald die Bedrohung nicht mehr gegenwärtig ist und die erste Benommenheit überwunden wurde.
Inzwischen bedenkt die Menschheitsseele ihr weiteres Vorgehen. Auch sie hat eine Entwicklung durchzumachen: Mit dem Auftreten des ersten Edelmenschen (Ben Tesalah) ändert sich der Charakter der Menschheitsseele; das alte Ideal der ethischen Vollkommenheit des Menschen war noch orientiert an den Bedingungen der Gewaltmenschenwelt: Gewaltmenschen müssen durch Qual und Härte auf den rechten Weg gewiesen werden. Die neue Menschheitsseele kann sich der ersten Edelmenschen bedienen, die dem Gewaltmenschen beistehen und als Beispiel dienen können. Zwar kann auch die neue Menschheitsseele nicht ganz auf die Läuterung durch Schmerz und Leid in der Geisterschmiede verzichten, doch wird sie dem Geprüften helfend zur Seite stehen. (34)
Der Gewaltmensch hat indes die Verunsicherung durch Kompromisse überwunden: Die aufgedeckten Verfehlungen des Rechts und der Religion werden ver-
| 34) | Die 1. Szene des 2. Aktes wäre besser an den Anfang des Stückes gesetzt worden (natürlich entsprechend modifiziert). Die Ablösung der alten Menschheitsseele durch die neue beginnt ja mit dem Auftreten des ersten Edelmenschen: Ben Tesalah tritt aber schon im 1. Akt auf. Akzeptabel wäre dann das Wirken Marah Durimehs als Phantasie immer noch: Für eine Übergangszeit sind beide Menschheitsseelen nebeneinanderwirkend durchaus denkbar (ja eigentlich sogar realistisch). |
tuscht: Rang und Ansehen dieser Institutionen sind für den eigenen Herrschaftsanspruch des Gewaltmenschen zu wichtig, als daß er sie ernsthaft angreifen könnte: Die Verfehlungen werden zu privaten Entgleisungen der Vertreter der Institutionen erklärt; der Angriff auf die Überheblichkeit der eigenen Person ist völlig verdrängt worden ("Man ist doch GEIST" F 127/ B 191)(35); nur das in der Verzweiflung hilfreiche Gebet, das vorher verachtet und verboten war, soll nun in Ehren gehalten werden, doch die dazugehörige religiöse Sicht wird weiterhin strikt abgelehnt.
Die Verdrängung des Zweifels an dem eigenen Selbstverständnis konnte dem Gewaltmenschen umso besser gelingen, als die erste Attacke der Menschheitsseele nicht öffentlich stattfand, seine Untergebenen und Verbündeten ihn also weiterhin in seinem falschen Anspruch unterstützen. Mit ihrer Hilfe soll dieser Anspruch dann auch einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber vertreten und durchgesetzt werden, denn bisher wurde dieser Anspruch ja nur vom eigenen Lager gebilligt.
Als erste tritt die Gewaltreligion für den Plan ein: Aufbauend auf der ihr vom Kreise der Angesprochenen allgemein und unangefochten entgegengebrachten Anerkennung und Sympathie, fällt es ihr nicht schwer, durch Hervorhebung gerade ihrer irdischen Momente bei den ja ans Irdische fixierten Gewaltmenschen erste Begeisterung hervorzurufen. Die den Herrschenden nahestehende, nach irdischen (36) Schätzen trachtende Wissenschaft treibt diese Begeisterung auf den Höhepunkt, indem sie durch eine geschickt Dokumente, Mythologien und Zukunftsvisionen vermischende Rede "beweist", daß die bevorstehende Auseinandersetzung nicht nur ein die Interessen der gemeinsamen Religion vertretender, sondern zugleich ein historisch gerechtfertigter, uralte Bestimmung einlösender Krieg ist.
Die Menschheitsseele wohnt dieser Versammlung im Hintergrund beobachtend bei; sie braucht noch nicht in die Geschehnisse einzugreifen: sie kann sich auf die jeglichem menschlichen Tun innewohnende Dialektik verlassen. Verfolgt man nämlich einen Gedanken bis zu seiner äußersten Konsequenz, so schlägt er automatisch in sein Gegenteil um: In ihrer Begeisterung verlieren die Gewaltmenschen bald das Nahziel aus den Augen und verraten mit dem heimlichen Endziel ihre wahren Absichten ("Ein Weltenreich! ... Den An'allah" F 145 f / B 205). Sofort schlägt die Zustimmung der Öffentlichkeit um in Gegnerschaft und Hohn.
Wut und Enttäuschung über die Niederlage läßt der Gewaltmensch nun an denjenigen aus, deren sklavisch-ergebener Treue er gewiß ist (37).
| 35) | Die Bamberger Bearbeitung verfälscht diesen Gedanken; Sie macht daraus: "Ich hab doch GEIST". (Hervorhebung von mir) |
| 36) | Die Archäologie als Symbol für am Irdischen ausgerichtete Wissenschaft gehört m.E. zu den gelungensten Bildern des Dramas. |
| 37) | May hat m.E. den schwarzen Vorbeter recht unglücklich als Symbol für den einfachen, obrigkeitshörigen, kindlich-gläubigen Untertan gewählt: Die dem Symbolgehalt entsprechenden Assoziationen, die beim Zuschauer geweckt werden sollen, wären: (Sklave)- einfältig - fromm - treu bis in den Tod. Diese Eigenschaften finden sich durchaus als Vorurteilskatalog für Neger. Aber nicht der afrikanische Farbige, den man im Drama doch wohl vor sich hat, der amerikanische Südstaaten Neger ist gemeint; (dazu vergleiche man 'Onkel Toms Hütte', Mark Twains Romane, 'Porgy and Bess' und - bei Karl May - 'Der Sohn des Bärenjägers' und 'Der Geist des Llano estakkado', GW Bd 35). Ich glaube aber, daß beim Publikum einer 'Arabischen Fantasia' keinesfalls Assoziationen aus dem amerikanischen Raum geweckt werden. Eine andere Deutung, die May selbst bietet: er hätte mit dem schwarzen Vorbeter diejenigen Anhänger einer Religion gezeichnet, die man gemeinhin die "Schwarzen" nennt, wäre allenfalls auf einer Ebene zeitbezogener Allegorisierung (wie sie die "Silberlöwe"-Bände bieten) akzeptierbar. Diese Ebene findet sich in 'Babel und Bibel' jedoch |
Doch auch hier stößt er plötzlich auf Widerstand; nicht aus Aufsässigkeit, aus Treue wird ihm nun der Gehorsam verweigert: Da dem unbeirrbaren Gefolgsmann von den Kämpfen und Kompromissen des Gewaltmenschen nichts bekannt ist, beharrt er aus Prinzipientreue auf den ursprünglichen Anweisungen, wie ja auch die begeisterten Anhänger stur und ohne taktisches Gespür dem Fernziel zujubeln, ohne Zeit und Umstände zu berücksichtigen (und damit den Plan zu Fall bringen).
Durch den Angriff auf den "guten Untertan" fordert der Gewaltmensch aber Recht und Religion heraus, deren Macht sich ebenfalls auf gerade diese Menschen stützt. Sie stellen sich schützend vor ihn und weisen den Gewaltmenschen barsch zurück. Ein derart öffentlich in die Enge getriebener Gewaltmensch ist jedoch nicht so leicht einzuschüchtern: Hier hilft nur noch Gegengewalt. Der Edelmensch greift ein; ruhig, sich seiner Überlegenheit und seiner edlen Absichten bewußt, tritt er dem impulsiven, blindwütigen Angriff des Gewaltmenschen entgegen und besiegt ihn schnell und unblutig.
Die ersten Schläge des Läuterungshammers sind auf den Gewaltmenschen niedergefallen; ohne Erfolg, ohne Verbündete, ohne Ansehen ist ihm jetzt die Chance gegeben, neu zu beginnen, seine Fähigkeiten in den Dienst edler Ziele zu stellen. Der Gewaltmensch sieht ein, daß sein bisheriges Leben in eine falsche Richtung führte ("Ich kämpfte mich bisher nur in die Tiefe; / Von heute an führt mich der Kampf empor" (F 200 / B 245) und erklärt sich bereit, Buße zu tun.
Auch für die Menschheitsseele bricht nun endgültig eine neue Ära an; die letzte Handlung der alten Menschheitsseele (38) steht schon ganz im Zeichen der neuen: Sie will dem Gewaltmenschen verzeihen und ihm die Schuld erlassen. Der Gewaltmensch aber ist seines Namens "Vater des Kampfes" eingedenk und nimmt den Läuterungsprozeß auf sich, denn nur den schwachen Menschen darf Hilfe zuteil werden, der Starke muß die Prüfung ertragen, um seinen Wert zu beweisen. Völlig auf sich gestellt wird aber auch er nicht mehr sein: Der Edelmensch wird ihm den rechten Weg weisen und ihm hilfreich zur Seite stehen. (39)
4.1.3. Die verschiedenen Leseebenen
Aus der Zugehörigkeit des Dramas zum Spätwerk Mays ergibt sich die Vermutung, daß auch hier mehrere Leseebenen unterschieden werden können. Die zwei bisher behandelten Leseebenen (äußere und symbolische Handlung) finden sich bei jedem Drama; es bleibt zu untersuchen, ob auch eine biographische (40) und eine psychologische (41) Ebene nachzuweisen sind.
Während die Darstellung der symbolischen Handlung sich nur auf das Drama
| nur ansatzweise und muß für die Deutung einer heutigen Aufführung gänzlich außer acht gelassen werden. Ein "Onkel Tom" wäre durchaus eine tragende Symbolgestalt - doch nicht vor dem Bühnenbild von 'Babel und Bibel': Ein kleines, dürres Männchen in schlichtem Kaftan, mit Fes und mit geschäftig-untertänigem Gehabe hätte hier mehr ausgesagt. | |
| 38) | Hier wäre nach dem in Anm.34 Vorgeschlagenen die "Übergangsphase" beendet. |
| 39) | In der vorliegenden Interpretation wird der Begriff 'Gewaltmensch' in zweierlei Bedeutung verwandt: Die An'allah - als Vertreter eines Großteils der Menschheit - sind die "gewöhnlichen" Gewaltmenschen, deren Emotionen und Weltbilder von den "hervorragenden" Gewaltmenschen (für die Abu Kital steht) gelenkt werden. |
| 40) | Biographisch heißt: die Zeit um die Abfassung des Dramas betreffend. |
| 41) | Psychologisch heißt: die Beziehungsgeflechte Mays zu den Personen seiner Kindheit betreffend. |
als Bühnenwerk stützte, muß für die Untersuchung dieser beiden Leseebenen das Drama als Lese-Drama betrachtet werden, d.h. es müssen sekundäre Quellen mit herangezogen werden. Bei der Entschlüsselung der biographischen und der psychologischen Ebene geht es darum, in den Akteuren des Dramas Personen oder Personifizierungen von Menschen und Geisteshaltungen aus dem Leben Karl Mays wiederzuerkennen. Dazu sind die Personen einzeln zu betrachten:
a) Abu Kital
"May hat in der langen Arbeit des Herauskristallisierens seiner Figuren bei Abu Kital an Sascha Schneider gedacht" (42). Diese These wird belegt durch einige Briefstellen; so zeigt sich Schneiders Gewaltmensch-Mentalität in den Worten:
| "Abu Kital wird besiegt, er muß sich den Weibern beugen. Mir wäre gewißlich lieber gewesen, wenn der Gewaltige, gewaltig an Geist und Körper, hartnäckig auf seinen Vorsätzen, seinen Fehlern und seiner Seelenqual bestehend, überwunden durch Männer nach fürchterlichem Kampf, in die ewige Verdammnis gefahren wäre. ... Es muß doch immer wieder erst alles zerrissen und zerwühlt werden, ehe ein neues Samenwort gesät werden kann. Der Acker braucht den Pflug, und die Menschheit den Krieg! Krieg! Blut und Wunden, damit wir wieder ein Geschlecht von Männern erhalten!" (43) |
Daß Karl May Schneider als Gewaltmenschen einschätzte, zeigt eine Stelle aus dem Antwortbrief: "Sie sind in meinen Augen ein Materialist, ein Substantialist, ein Naturalist, ein Somatist ... " (44). Ein weiteres Indiz für Schneiders Konterfei in Abu Kital ist, daß das Drama ihm (inoffiziell) gewidmet ist: "In ERSTER LINIE ist 'Babel und Bibel' für keinen Andern als nur für Sascha Schneider ganz allein geschrieben worden." (45)
In dem Kapitel 'Sascha Schneider - Der Chodem' weist Hatzig darauf hin (46), daß May mehrfach durch Bilder von Schneider zu Motiven seiner Romane angeregt wurde. Für die Entschlüsselung Abu Kitals scheint mir ein frühes Bild Schneiders wichtig: das Bild 'Herr der Erde': "Der orientalische Despot ... steht 'in stolzer Herrscherpose und Armverschränkung vor seinem Marmorthron und tritt das Bild dessen, der die Massen zu befreien kam, mit Füßen. '" (47)
Auf der psychologischen Ebene handelt es sich bei Abu Kital um Mays Vater. Dazu vergleiche man die Beschreibung des Scheiks: "... Gewaltmensch, aber zur Veredelung veranlagt. Körperlich und geistig vollkräftig und gewandt. Impulsiv. Aufstrebend, aber in falsche Richtung geleitet. ... Sein Auftreten ist rauh, gegen Schefaka aber von weichster Gutmütigkeit" (F 11 / B 103) mit der Beschreibung, die May von seinem Vater gibt: "Mein Vater war ein Mensch mit zwei Seelen. Die eine Seele unendlich weich, die andere tyrannisch, voll Übermaß im Zorn, unfähig, sich zu beherrschen. Er besaß hervorragende Talente, die aber alle unentwickelt geblieben waren, der großen Armut wegen" (48). Auch die Peitsche als ständiges Attribut findet
| 42) | Hansotto Hatzig: 'Karl May und Sascha Schneider' - a.a.0. S. 149 |
| 43) | ebda. - S. 121 (Brief Schneider an May v. 3.7.06) |
| 44) | ebda. - S. 129 Brief May an Schneider v. 16.9.06) |
| 45) | ebda. - S. 112 Brief May an Schneider o. Datum (März 06) |
| 46) | ebda. - S. 33 ff |
| 47) | ebda. - S. 26.- Ebenfalls wichtig: Das Bild 'Hohes Sinnen' - a.a.0.- Tafel 48.- Nicht nur die Bilder Schneiders beeinflußten Mays Denken: Aus der charakterlichen Anlage und der gesamten Denkweise Schneiders schließe ich, daß das recht plötzlich auftretende (für Mays Weltbild allerdings nicht sehr folgenreiche) Interesse für Nietzsche von Sascha Schneider ausging. |
| 48) | Karl May: 'Mein Leben und Streben' - (Reprint) - a.a.0. - S. 9 |
sich bei Abu Kital wie bei Mays Vater(bild); Abu Kital: "Hat stets die Peitsche in der Hand" (F 11 / B 103) - Mays Vater: "Am Webstuhl hing ein dreifach geflochtener Strick, der blaue Striemen hinterließ, ... man (bekam) den Strick ... so lange, bis Vater nicht mehr konnte" (49).
Ein weiterer Hinweis ist die Stimmigkeit der Altersangaben für Abu Kital und Ben Tesalah (der den Sohn May repräsentiert): Abu Kital ist "ungefähr fünfzig Jahre alt", Ben Tesalah ist "Nicht viel über zwanzig Jahre alt" (beide F 11 / B 103). Die gleiche Altersdifferenz besteht auch zwischen Heinrich August May (geb. 1810) und Karl May (geb. 1842). Falls diese Daten von May bewußt in seine Konzeption mit einbezogen worden sind, ergibt sich eine weitere interessante Datenkombination: Als Mays Vater 51 Jahre alt war (1861), kehrte May (19-jährig) aus dem Lehrerseminar zurück; der Sohn hatte den Aufstieg aus dem "tiefsten Ardistan" geschafft.
Die psychologische Deutung Abu Kitals als Mays Vater deckt aber nur die halbe Verschlüsselung auf: Abu Kital ist auch May selber: der May nämlich, der in seinen Abenteuerromanen die vaterorientierten Ich-Projektionen Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi schuf.
Unter diesen Aspekten enthält das Drama 'Babel und Bibel' das Motiv des Vater-Sohn-Konfliktes und zugleich den Kampf der "zwei Seelen" in der Brust des Karl May.
b) Ben Tesalah
Wie schon vorweggenommen, repräsentiert der "Sohn des Friedens" auf der psychologischen Ebene den Sohn Karl May. Da Ben Tesalah im Drama nur sehr dürftig beschrieben wird, kann der Nachweis für diese Deutung nur unvollkommen ausfallen. Neben der aufgezeigten Altersbeziehung und dem auch in der Oberflächenhandlung bestehenden Familienverhältnis Vater (Abu Kital), Mutter (Bent'ullah) und Sohn (Ben Tesalah), bietet ein Vergleich zweier Stellen aus Mays Selbstbiographie mit Texten des Dramas Anhaltspunkte:
May beschreibt seinen Aufenthalt im Landesgefängnis Zwickau (1865-68) unter anderem mit den Worten "Ich war angekettet im tiefsten, niedrigsten, verachtetsten Ardistan und schickte meine ganze Sehnsucht und alle meine Gedanken zum hellen, freien Dschinnistan empor" (50). Ben Tesalah schildert seinen Aufenthalt in der Geisterschmiede ähnlich:
| "Da lag ich einst, gefesselt und geknebelt, Im Feuer -- in der Glut -- um Stahl zu werden -- ... Doch war ich still -- ich trug die Qual und schwieg -- ... Da schrie ich auf, doch nur in meinem Innern, Zu Gott, dem Herrn, daß er mir helfen möge." (F 119 / B 185) |
Auch die äußere Erscheinung Ben Tesalahs ist vergleichbar mit einer Beschreibung des jungen May: "Dieser Mensch, der da stand, war doch nicht etwa ich? An den die eigene Mutter nicht mehr glaubte? Wer war der Kerl, der in seiner schmutzigen, verknitterten Kleidung aussah, wie ein Vagabund?" (51): "Es lagert eine Todeskarawane / ... / Wohl vierzig Männer stark, zerlumpt, zerrissen / ... / Ihr Scheik ... / ... ebenso verkommen wie die Andern" (F 46 / B l32) und: "Er wurde schmutzig wie ein Ungeziefer / Im Dorngestrüpp der Wüste aufgefunden" (F 34 / B 123).
Dreimal (!) im Drama wird Ben Tesalah als "Wechselbalg", "Bankert" und
| 49) | ebda. - S. 10 f - Vgl. auch H. Wollschläger: 'Der Besitzer von vielen Beuteln' - Jb-KMG 1974 - S. 160 |
| 50) | Karl May: 'Mein Leben und Streben' - (Reprint) - a.a.0. - S. 135 |
| 51) | ebda. - S. 167 |
"Bastard" beschimpft (52). In Zusammenhang mit der Hypothese Wollschlägers (53), daß Mays Mutter um die Zeit 1844/45 einen Liebhaber hatte, sei die Frage gewagt, ob sich hier widerspiegelt, was May als kleines Kind vom Vater des öfteren zu hören bekommen hat (oder hörte, daß die Worte der Mutter vorgehalten wurden), ob May vielleicht einer außerehelichen Liaison entstammt (wie übrigens sein Vater (ja auch)).
Auf der biographischen Ebene wird Ben Tesalah von Hansotto Hatzig gedeutet als May, wie er sich zur Zeit des Dramas sah:
| "May hat ... bei Abu Kital an Sascha Schneider gedacht, bei Ben Tesalah jedoch möglicherweise an sich selbst, wobei es ihm nicht schwer fiel, die Altersunterschiede umzukehren, da er sich dem KÜNSTLER gegenüber im Rang des Schülers sah. ... Ben Tesalah hat sich den inneren Frieden und auch den Frieden in anderen Beziehungen errungen und will ihn nun seinen Nebenmenschen bringen. Diese Deutung Mays aus der 'Skizze' ist viel mehr eine Charakteristik seiner selbst (wie er sich zu sehen wünschte) als eine Charakteristik seiner Figur Ben Tesalah." (54) |
c) Bent'ullah
Über Bent'ullah, die "Tochter Gottes", wird im Drama noch weniger gesagt als über Ben Tesalah. Hansotto Hatzig macht darauf aufmerksam, daß May in der Erstfassung der Bent'ullah eindringlichere Züge verliehen hatte. Er zitiert eine der gestrichenen Stellen der Erstfassung: (Ben Tesalah über Bent'ullah):
| "Und diese Augen, diese Wunderaugen! Auch diese sah ich schon! - Ob sie es waren? Das Heiligste, was es auf Erden gibt, Die ganze Liebe aller Menschenhimmel Und alle Seligkeit, die sich erdenken läßt, Das leuchtete aus ihnen auf mich nieder!" (55) |
Und auch Abu Kital beschreibt seine Frau ähnlich:
| "Das Heiligste auf Erden! Sie war so rein, so schön, fast überirdisch, Mit strahlendem Gesicht und wunderbaren, Noch völlig unerforschten Sternenaugen." (F 70 / B 149) |
Damit vergleiche man eine Stelle aus 'Und Friede auf Erden':
| "Die andere Seite enthielt das Bild der Schreiberin. Eine schöne, vielleicht vierzig Jahre zählende Frau, die mir bekannt vorkam, umso bekannter, je länger ich die Photographie betrachtete. Wo hatte ich diese warmen Seelenaugen geschaut, deren Blick unablässig um irgendetwas zu bitten schien?" (56) |
| 52) | F 35 / B 123, F 45 / B 132 (gestrichen) und F 200 / B 245 In der Urfassung finden sich die Worte "Bastard"/"Bankert"/"Wechselbalg" nicht |
| 53) | Vgl. Hans Wollschläger: 'Die sogenannte Spaltung des menschlichen Innern ... ' Jb-KMG 1972/73 - S. 30 ff. |
| 54) | Hansotto Hatzig: Karl May und Sascha Schneider' - a.a.0. - S.149 |
| 55) | ebda. - S. 149 |
| 56) | Karl May: GW Bd 30: 'Und Friede auf Erden' - Freiburg - S. 130 Vgl. Karl May: GW Bd 30: 'Und Friede auf Erden' - Bamberg - 1958 (177. Tsd.) - S. 121. Diese Textstelle wurde von May erst 1904 in den Roman eingepaßt. Die Spekulation bezüglich der Altersbeziehungen im Drama läßt sich auch hier fortführen: Mays Mutter (geb. 1817) war 1861 44 Jahre alt. |
Die hier Beschriebene ist Mrs. Waller, Ma(r)ys Mutter: Bent'ullah steht für Mays idealisiertes Mutterbild.
d) Marah Durimeh
In 'Mein Leben und Streben' nennt Karl May als Urbild für Marah Durimeh seine (Ernstthaler) Großmutter, bei der er den Großteil seiner Jugend verbracht habe und die ihn durch Märchen und Geschichten, durch ihr ganzes Wesen nachhaltig beeinflußt habe. Wollschläger weist nach (57), daß alle biographischen Angaben Mays über seine Großmutter nicht stimmen; daraus zieht er den Schluß: "May hat sein Verhältnis zur Großmutter stets so 'offen' dargestellt .... daß die Gleichsetzung mit Marah Durimeh wiederum als Deckung erkennbar wird." (58)
Marah Durimeh tritt im Werk Karl Mays mehrfach auf. Zuerst kommt sie in GW Bd 2 'Durchs wilde Kurdistan' vor (1881/1892), dann taucht sie in GW Bd 27 'Im Reiche des silbernen Löwen II' (1898) wieder auf. May beschreibt sie so:
| "Ich ... erblickte eine alte Frau, deren Äußeres mich schaudern machte. Sie schien ihre hundert Jahre zu zählen; ihre Gestalt war tief gebeugt und bestand wohl nur aus Haut und Knochen; ihr fürchterlich hageres Gesicht machte geradezu den Eindruck eines Totenkopfes, aber von ihrem Haupte hingen schwere weiße Haarzöpfe fast bis auf den Boden herab." (59) |
Vergleicht man damit die Signalemente Marah Durimehs in 'Babel und Bibel' (und im 'Mir von Dschinnistan')
| "Hohe, grad und aufrecht getragene Figur. Höchste Würde, die umso mehr ergreift, als sie im Gegensatz zu diesem Alter der Anmut nicht entbehrt. Edle, leicht gebräunte Gesichtszüge, mit einigen Alterslinien, die aber keine Falten sind. Langes, sehr volles, schneeweißes Haar, welches in zwei starke Zöpfe geflochten ist, die nach vorn geleitet sind und fast die Erde berühren." (F 13 / B 105), |
so fällt die starke Idealisierung dieser Person sofort ins Auge. Die Person aber, die seit 1900 von May stark idealisiert wurde, ist seine Mutter. Dazu noch eine Stelle aus 'Und Friede auf Erden': "Die Frau, welche ich früher als 'Gespenst' bezeichnete, ist mir so vertraut geworden" (60). Auf Mays Mutter verweist zudem noch die Beschreibung des Liebeslebens der Großmutter: "Sie hatte einen Geliebten ... aber sie verzichtete. Sie wollte ganz allein dem Vater gehören" (61).
Das widersprüchliche Bild, das aus der Diskrepanz zwischen Mays Angaben und den Hinweisen auf Mays Mutter entsteht, läßt sich bei der spärlichen Beschreibung Marah Durimehs im Drama nicht auflösen. Ganz so unrecht wird Karl May mit seinem Hinweis auf die Großmutter schließlich auch nicht haben, immerhin wohnte sie im Haus der Eltern, und oft genug wird sie den kleinen Karl beaufsichtigt haben. Eine andere Person aus Mays Leben darf
| 57) | Hans Wollschläger: 'Die sogen. Spaltung ... ' a.a.0. S. 31 f. |
| 58) | ebda. - S. 88 (Anm. 65) |
| 59) | Karl May: GW Bd 2: 'Durchs wilde Kurdistan' Radebeul o.J. (172.-186. Tsd.) - S. 207 In 'Silberlöwe' II findet sich eine damit übereinstimmende Beschreibung (Radebeul 43.-48.Tad. S.606 f. - Vgl. auch: Die Wandlung des Marah-Durimeh-Bildes in Annelotte Pielenz, 'Karl Mays Illustrierte Reiseerzählungen Band I-IX', Sonderheft d. KMG Nr. 9/1977 - S. 5 f. |
| 60) | Karl May: GW Bd 309 'Und Friede auf Erden' - Freiburg S. 480 Bamberg - a.a.0. - S. 429 |
| 61) | Karl May: 'Mein Leben und Streben' - (Reprint) - a.a.0. - S. 21. Vgl. dazu H. Wollschläger: 'Die sogenannte Spaltung ...' - s. 32 - |
im vorliegenden Zusammenhang auch keinesfalls außer acht gelassen werden: Der in der Biographie verschwiegene Pate Christian Weisspflog (62), über den May an anderer Stelle schreibt:
| "Ich hatte einen Paten ... Der nahm mich in der Dämmerstunde und an Feiertagen ... gern zwischen seine Kniee, um mir und den rundum sitzenden Knaben von seinen Fahrten und Erlebnissen zu berichten. ... (Er) war ... ein gar gewaltiger Erzähler, voll übersprudelnder, mit in das Alter hinüber geretteter Jugendlust und Menschenliebe. .. Er hat seine letzte Wanderung schon längst vollendet; ich aber erzähle an seiner Stelle weiter. ... ich will meinen Lesern das sein, was meine Großmutter und mein Pate mir gewesen sind" (63). |
Zusammenfassend ergibt sich, daß May in Marah Durimeh die Kindheitserinnerungen an Großmutter und Paten mit dem Idealbild der Mutter verschmolz.
e) Hakawati
Über den Hakawati ist nicht viel zu sagen: In ihm spiegelt sich der Schriftsteller May, wie er sich nach 1900 gern sah: Der gütige, sagen- und märchenerzählende Friedensmahner. Auf der psychologischen Ebene hat er wohl auch an dem Erinnerungs-Konglomerat Großmutter/Pate teil.
f) Schefaka
| "Schefaka ... scheint von Anfang an etwas verzeichnet. Nichtsdestoweniger dachte May bei ihr, dem Modell zur Seele, an seine Klara, die das nicht zuletzt dadurch verriet, daß sie bei ihrer eigenhändigen Abschrift eines May-Briefes an Schneider für Schefaka versehentlich Schakara einsetzte" (64). |
Auf der psychologischen Ebene repräsentiert Schefaka Mays Vorstellungen von der "idealen" Frau: kindlich-naiv, dienend, vom "unwiderstehlich schüchternen, 'jugendliebenhaften'" Typ (Arno Schmidt), der dem Idealbild der Mutter ähnlich ist (Kleidung der Seele).
g) Sonstige
Ob Imam, Kadi, Vorbeter und Babel auf der biographischen Ebene bestimmten Personen nachgebildet sind, oder ob sie Vertreter von Recht, Religion, Wissenschaft und den "gläubigen, kirchenhörigen Katholiken" der wilhelminischen Zeit allgemein nachbilden, läßt sich aus dem Drama nicht ableiten.
Der Inhalt des Dramas läßt sich (grob zusammengefaßt) nach den verschiedenen Leseebenen getrennt so darstellen (65):
äußere Ebene:
| Abu Kital plant einen Feldzug gegen die edlen Kiram. Er wird besiegt und gefangengenommen. Bei den Kiram findet er Frau und Sohn wieder und erhält die Möglichkeit, seine Vergehen zu büßen, um ein besserer Scheik der An'allah zu werden. |
| 62) | Christian Weisspflog war Schmiedemeister; vielleicht besteht eine unterschwellige Beziehung vom Paten zur Herrin der Geisterschmiede daher |
| 63) | Karl May (Ps. Richard Plöhn): 'Karl May und seine Gegner' in 'Tremonia', Dortmund v. 27.9.1899 - Wiederabgedruckt in Jb-KMG 1974, S. 132 f. |
| 64) | Hansotto Hatzig: 'Karl May und Sascha Schneider' - a.a.0. - S. 150 Schakara ist bekanntlich das Konterfei Klara Mays in "Silberlöwe" III und IV und im 'Mir von Dschinnistan' |
| 65) | Zur Verschränkung der Leseebenen untereinander verweise ich auf Ekkehard Koch: 'Winnetou Band IV' - Versuch einer Deutung 2. Teil - Jb-KMG 1971 - S. 285 f. |
symbolische Ebene:
| Der Gewaltmensch, dessen Trachten auf äußerlichen Erfolg gerichtet ist, wird von der Menschheitsseele mit Hilfe des Edelmenschen, dessen Denken sich an "hohen Idealen" orientiert, zum Edelmenschen umerzogen. |
psychologische Ebene:
| Karl May überwindet die Identifikation mit dem (rohen)Vater; die frühkindliche Bindung an die Mutter gewinnt die Oberhand: Der DR. Karl May, alias Old Shatterhand, alias Kara Ben Nemsi wandelt sich zum Prediger der Menschlichkeit und des Friedens. |
biographische Ebene:
| Karl May, der Künder des Friedens, versucht, seinen Freund, den "wilhelminisch" denkenden Künstler Sascha Schneider, zum Edelmenschentum zu bekehren. |
4.2.1. Die innere Technik (Dramaturgie)
| "'Babel und Bibel' ist eine ARABISCHE PHANTASIE. Es wird also kein wahrer Kenner, der da weiß, was das ist, an mich die Forderung stellen, mich, indem ich sie schreibe, nach europäischen, also ganz unpassenden Kunstgesetzen zu richten. Das stelle ich voran" (66). |
Da Mays Bibliothek eine ganze Reihe von Werken enthält, die sich mit den 'europäischen Kunstgesetzen' bezüglich des Aufbaus von Dramen beschäftigen (67), liegt die Vermutung nahe, daß obige Bemerkung mehr der Absicht entsprang, beckmessernden Kritikern der ihm feindlich gesonnenen Presse vorzubeugen, als auf grundlegende Veränderungen des dramaturgischen Aufbaus bei 'Babel und Bibel' hinzuweisen.
'Babel und Bibel' besteht aus nur 2 Akten und entspricht damit - zumindest äußerlich - nicht dem Aufbau des klassischen (fünfaktigen) Dramas. Daß jeder dieser beiden Akte genau 1.000 Verszeilen umfaßt, soll wohl auf eine Symmetrie der Anlage des ganzen Stückes verweisen. In der Tat läßt sich eine solche erkennen:
Der 1. Akt beginnt mit einer Beratung, in der zwei große Reden (Hakawati und Kadi/Abu Kital) gehalten werden, sie schließt mit allgemeiner Begeisterung. Es folgt ein "Zwischenspiel", das den Hintergrund gewaltmenschlichen Denkens vorstellt. Dann tritt der Gegenspieler (Scheik der Todeskarawane) des "Helden" (Abu Kital) auf und "besiegt" ihn (psychologisch). Der Schluß zeigt den Helden in einer Krise.
Auch der 2. Akt beginnt mit einer Beratung, der das "Zwischenspiel" diesmal vorausgeht, indem jetzt das edelmenschliche Denken vorgestellt wird (68). Die Beratung gipfelt wieder in zwei. Reden (Imam und Babel). Diese Beratung endet allerdings mit einem Fiasko. Der Gegenspieler des Helden tritt auf und besiegt ihn nun endgültig. Der Schluß zeigt den Helden als Überwinder der Krise, als "Sieger über sich selbst".
Auf diese Weise hat May quasi zwei Dramen in einem geschrieben. Jeder Akt zerfällt nämlich in zwei Hälften: In der ersten Hälfte agiert der Held,
| 66) | Karl May: 'Skizze zu Babel und Bibel' - a.a.0. - S. 68 Vgl. GW Bd 49 - a.a.O. - S. 272 |
| 67) | Siehe S. 13 dieser Arbeit |
| 68) | Die von mir vorgeschlagene Änderung bezüglich des Anfangs des 2. Aktes berührt diese Symmetrie nicht, da sie sich nur auf das Gespräch der Menschheitsseelen erstreckt: Die Symmetrie würde sogar noch stärker ins Auge fallen: der Bekleidung der Seele im 1. Akt stände dann die Entkleidung der Seele im 2. Akt gegenüber. |
in der zweiten Hälfte wird er vom Gegenspieler zu passiver Haltung gezwungen. Damit entspricht jeder Akt einem von Gustav Freytag vorgestellten Dramentyp: In der ersten Hälfte des Stückes erscheint der Held "in einseitigem aber erfolgreichem Begehren, von innen nach außen wirkend, die Lebensverhältnisse, in denen er auftrat, mit sich verändernd.", in der zweiten Hälfte "wirkt das, was er gethan hat, auf ihn selbst zurück und gewinnt Macht über ihn"(69).
Der Umschlag von der "aufsteigenden" zur "absteigenden" Handlung des Stückes erfolgt im ersten Akt mit dem Auftritt des Scheiks der Todeskarawane (14. Auftr.), im 2. Akt wird er durch die Worte der Phantasie im 10. Auftritt gekennzeichnet: "Sie läßt den Gegner Zug um Zug gewinnen, / Bis fast zuletzt; dann aber greift sie ein" (F 147 / B 2 0 7).
Den Aufbau des klassischen Dramas in einem Akt vollständig nachzubilden, war May wohl nicht möglich; aber eine ganze Reihe der Elemente des klassischen Dramas sind in 'Babel und Bibel' wiederzuerkennen:
Der "Einleitung" (70) des klassischen Dramas entsprechen die Auftritte 1-3 im ersten und der Beginn des "Zwischenspiels" im zweiten Akt. Als "Steigerung" können die Auftritte 4 und 5 des 1. Aktes und der 10. Auftritt des 2. Aktes gelten. Einen "Höhepunkt" im Sinne des klassischen Dramas hat 'Babel und Bibel' nicht, da der "Held" ja keine Tat vollbringt; man kann allerdings den Auftritt des Scheiks der Todeskarawane (14. Auftr.) im ersten Akt und im zweiten Akt den 11. Auftritt (ebenfalls einer des Scheiks der Todeskarawane) so bezeichnen, womit dann der "Höhepunkt" beider Akte gleichzeitig "Fall und Umkehr" wäre. Eine "Katastrophe" fehlt im ersten Akt; im zweiten Akt findet die Kapitulation des "Helden" im 21. Auftritt statt, was aber in 'Babel und Bibel' nicht als "Katastrophe" gelten kann, da dem "Helden" Verzeihung und eine bessere Zukunft zuteil wird. Zum katastrophenfreien Schluß paßt Mays dem Drama vorangestellter Vierzeiler:
| "Gott schrieb die Schöpfung nicht als Trauerspiel; Ein tragisch Ende kann es nirgends geben. Zwar jedes Leben ringt nach einem Ziel, Doch dieses Ziel liegt stets im nächsten Leben." (F 3 / B 97) "Laß auch die Seele, nicht nur die Gestalten, aus seiner Welt an dir vorübergleiten, dann wird vor dir die Bühne sich entfalten, auf der die Menschen zur Vollendung schreiten." (71) |
4.2.2. Die äußere Technik (Form) des Dramas
Karl May hat für sein Drama den fünffüßigen Jambus verwendet. Seine Entscheidung, gebundene anstatt ungebundene Rede zu verwenden, ist mehr mit Mays Kunstauffassung im allgemeinen als aus vom Inhalt des Dramas geforderten Notwendigkeiten zu erklären. In Freytags "Technik des Dramas" heißt es zu gebundener Rede:
| 69) | Gustav Freytag: 'Die Technik des Dramas'- Leipzig -7 1894 - S. 95 Da Karl May dieses Werk (in der 9. Auflage, 1901) besaß und mir Freytags und Mays pathetische Kunstauffassung verwandt erscheinen, habe ich dieses (vereinfachende und einseitige) Werk für die Besprechung der "Technik" von 'Babel und Bibel' zugrundegelegt. |
| 70) | Begriffe nach G. Freytag: 'Die Technik des Dramas' - a.a.0. - S. 102 ff. |
| 71) | Die 2. Strophe findet sich nur in der Bamberger Ausgabe. May gebrauchte diese 2. Strophe zu Widmungszwecken (siehe Mitt. KMG 11/20 und Mitt. KMG 21/3: Beide Widmungen weisen den Bamberger Text als verfälscht aus: Es heißt jeweils "Laß auch die Seelen ... Aus meiner Welt ... So wird vor dir ... " |
| "Aber diese Vortheile (sc. die der ungebundenen Rede) werden reichlich aufgewogen durch die gehobene Stimmung des Hörers, welche der Vers hervorbringt und erhält. Während die Prosa leicht in Gefahr kommt, die Bilder der Kunst zu Abbildern gewöhnlicher Wirklichkeit herabzuziehen, steigert die Sprache des Verses das Wesen der Charaktere in das Edle. In jedem Augenblick wird in dem Hörer die Empfindung rege erhalten, daß er Kunstwirkungen gegenübersteht, welche ihn der Wirklichkeit entrücken und in eine andere Welt versetzen, deren Verhältnisse der menschliche Geist mit Freiheit geordnet hat. ... In dem rhythmischen Klange des Verses schweben, der Wirklichkeit enthoben, Empfindung und Anschauung wie verklärt in die Seelen der Hörer." (72) |
Das Pathos dieser Worte paßt genau zu dem Stil, in den May fällt, wenn er von Kunst spricht:
| "Für das Theater schreiben! Dramen schreiben! Dramen, in denen gezeigt wird, wie der Mensch aufsteigen soll und aufsteigen kann aus dem Erdenleide zur Daseinsfreude, aus der Sklaverei des niedern Triebes zur Seelenreinheit und zur Seelengröße. " (73) |
Für die Wahl des Versmaßes wird der Aspekt der "Bequemlichkeit" nicht unwesentlich gewesen sein: "Der fünffüßige Jambus ist bei uns als dramatischer Vers seit Goethe und Schiller durchgesetzt. Ein vorwiegend trochäischer Fall der deutschen Wörter macht diesen Vers besonders bequem" (74). Es sei daran erinnert, daß May schon in den Prosatext der "Silberlöwe"-Fortsetzungen Blankverse unvermittelt eingeflossen waren; daran zeigte sich ihm, daß dieses Versmaß ihm "lag".
Daß einem deutschen Dichter jambische Verse gelingen, liegt für Freytag in der Natur der deutschen Sprache. Ein Drama in Jamben zu verfassen, ist demnach noch keine "große Kunst": "der Dichter (muß) eine andere Art von rhythmischer Empfindung gewinnen, welche ihn veranlaßt, an Stelle der Regelmäßigkeit scheinbare Unregelmäßigkeit zu setzen, den gleichartigen Fluß in der mannigfaltigsten Weise zu stören, das heißt, mit stark bewegtem Leben zu erfüllen." (75)
Im Anschluß an diese Forderung führt Freytag aus, welche Möglichkeiten dem Dichter zur Verfügung stehen, den jambischen Fünffuß zum 'dramatischen Vers' aufzuwerten: "In den Jambus des Dramas tritt ... Leben dadurch ein, daß es den gleichmäßigen Bau des Verses unterbricht, aufhält und zerhackt" (76). May hat alle diese Möglichkeiten ausgenutzt. Durch Hauptsatz-Nebensatz-Gefüge (meist verwendet er Relativsätze), durch Aufzählung, Wiederholung und Reihung kurzer Hauptsätze erreicht er Zäsur- und Akzentverschiebungen, die Eintönigkeit im Vers verhindern. Selten macht May Gebrauch von der Möglichkeit, das Kolon (77) bis in die nächste Zeile reichen zu lassen ("Nur wer Sitara kennt, das wunderbare / und hochgelegne Land der Sternenblumen" (F 44 / B 131); allzu häufig dagegen teilt Karl May den Vers auf mehrere Sprecher auf. Beispiele wie: "Erster Ältester: Die Taten warten! / Zweiter Ältester: Die Taten warten! Dritter Ältester: Die Taten warten! / Alle: Die Taten warten!" (F 45 B 131) wirken (zumal wenn sie wie ein Kanon gesetzt sind, damit Versmaß und Verszeile gewahrt bleiben) in der Häufung gekünstelt und eher parodistisch. Sieht man einmal von diesem Mangel ab, kann gesagt werden, daß die verstechnische Gestaltung des Dramas keine Mängel aufweist.
| 72) | Gustav Freytag: 'Die Technik des Dramas' - a.a.O. - S. 279 |
| 73)) | Karl May: 'Mein: Leben und Streben' -(Reprint)- a.a.O. - S. 150 |
| 74) | Gustav Freytag - a.a.O. - S. 279 |
| 75) | ebda. - S. 283 |
| 76) | ebda. - S. 284 |
| 77) | für Nicht-Germanisten: Kolon - "auf der Atempause beruhende rhythmische Sprecheinheit". |
5. Z u s a m m e n f a s s e n d e W e r t u n g
Der Wert eines Dramas kann einmal darin liegen, daß es ein allgemeinmenschliches Problem in überzeugender Weise darstellt, oder aber darin, daß es Vorläufer (beispielsweise in formaler Hinsicht) oder wichtige Station in der Entwicklungsreihe einer Erscheinungsform des Dramas ist. Der "Vorläufer"-Aspekt kann bei 'Babel und Bibel' vorerst ausgeschlossen werden, da das Stück bisher kaum gelesen und überhaupt noch nicht aufgeführt wurde.
Hans Wollschläger ordnet 'Babel und Bibel' "seiner inneren Gestik nach" unter die "Jedermann-Mysterien" (78) ein; dem kommen Mays Worte
| "ich (komme) mit den bisher verfaßten Anschauungsbüchern nicht mehr aus, sondern ich muß zum Anschauungsdrama übergehen, weil dies die deutlichste, eindringlichste und darum auch erfolgreichste aller Lehr- und Predigtformen ist." (79) |
entgegen. Wichtige Station in der Reihe der" "Jedermann-Mysterien" wäre 'Babel und Bibel' dann, wenn es der ersten Forderung (überzeugende Darstellung) Genüge täte, oder wenn es eine neue Lösung des Problems anzubieten hätte (die, wenn die Darstellung nicht akzeptabel ist, "Vorläufer"-Charakter für spätere Stücke erhielte).
Daß Anklänge an die Jedermann-Mysterienspiele in 'Babel und Bibel' zu entdecken sind, will ich nicht bestreiten. Aber: Das für die Jedermann-Spiele charakteristische Moment ist, daß der personifizierte Tod dem am Irdischen orientierten Menschen gegenübertritt und ihn an das nahe Ende mahnt. In 'Babel und Bibel' wird Abu Kital zwar mit seinem "nahen Ende" bedroht; doch ist hier weder der Tod sein Gegenüber, sondern der hilfreiche Edelmensch, noch geht es realiter um das Ende des Lebens, sondern um einen Sinneswandel für ein neues Leben. Die Verwandtschaft 'Babel und Bibel's mit den Jedermann-Spielen ist also recht entfernt.
Ich folge also nicht der Anregung Wollschlägers, sondern werde 'Babel und Bibel' im Zusammenhang der durch alle literarischen Gattungen und Epochen zu verfolgenden Thematik "Edelmensch kontra Gewaltmensch" betrachten. Diese Thematik klingt beispielsweise an in Sophokles' 'Antigone', in Schillers 'Wilhelm Tell' und in den Brecht-Stücken 'Die heilige Johanna der Schlachthöfe', 'Herr Puntila und sein Knecht Matti' und 'Der gute Mensch von Sezuan'. Die Konfrontation Edelmensch/Gewaltmensch geht in den genannten Theaterstücken jeweils verschieden aus: In der 'Antigone', läßt der Gewaltmensch Kreon den Edelmenschen Antigone einmauern, verliert aber dadurch seinen Sohn; im 'Wilhelm Tell' wird der Gewaltmensch Gessler vom edlen Tell erschossen; in 'Babel und Bibel' kann der Gewaltmensch Abu Kital vom Edelmenschen Ben Tesalah zum Edelmenschen umerzogen werden; ein Kompromiß zwischen gewaltmenschlicher Komponente und edelmenschlicher Gesinnung wird in Brechts 'Der gute Mensch von Sezuan' geschlossen: um in der gewaltmenschlich orientierten Welt überleben zu können, muß der Edelmensch sich ab und zu in einen Gewaltmenschen verwandeln; in der "Johanna" Brechts wird das edelmenschliche Denken der Johanna den ausbeuterischen Interessen des Gewaltmenschen Mauler dienstbar gemacht, und im "Puntila" verläßt der "edle" Matti den Gewaltmenschen Puntila, da ihm eine "Bekehrung" nicht möglich erscheint.
Alle möglichen Lösungen des Edelmensch-Gewaltmensch-Themas sind durchgespielt worden: a) Der Gewaltmensch siegt ("Johanna") oder erzielt einen Pyrrhus-Sieg ("Antigone"); b) der Gewaltmensch bleibt Gewaltmensch, der Edelmensch zieht sich zurück ("Puntila"); c) Gewaltmensch und Edelmensch ergänzen sich einander ("Sezuan"); d) der Edelmensch siegt gewaltmensch-
| 78) | Hans Wollschläger: 'Karl May' - a.a.O. S. 139 f. |
| 79) | Karl May: 'Skizze zu Babel und Bibel' - a.a.O. - S. 55. Vgl. GW Bd 49 - a.a.O. - S. 262 |
lich durch Gewalt ("Tell") und e) der Edelmensch siegt seiner Wesensart gemäß, indem er den Gewaltmenschen zum Edelmenschen umerzieht (May).
Ganz neu ist Karl Mays Lösung allerdings nicht: Auch in Schillers Ballade 'Die Bürgschaft' wird der Gewaltmensch umerzogen (ein weiteres Beispiel wäre Goethes 'Iphigenie auf Tauris', obwohl Thoas nur bedingt als Gewaltmensch bezeichnet werden kann). Vergleicht man nun Mays Begründung für den Gesinnungswandel des Gewaltmenschen mit der in Schillers "Bürgschaft", so ergibt sich ein grundlegender Unterschied: Bei Schiller wird der Tyrann durch das überzeugende Beispiel edelmenschlichen Denkens und Handelns erschüttert und genau dadurch zur Wandlung bewogen. In 'Babel und Bibel' wird die Wandlung durch mannigfache äußerliche Einwirkung auf den Gewaltmenschen und seine Umgebung bewirkt. Es sieht allerdings so aus, als gäbe Abu Kital sich wegen der unerwarteten Freilassung durch Ben Tesalah (F 185/ B 234) geschlagen, aber die "Hauptarbeit" der "Bekehrung" wurde durch die stufenweise Entmachtung geleistet (Ben Tesalah geht mit der Freilassung Abu Kitals ja auch gar kein Risiko ein, da das Lager umzingelt ist). mir scheint, daß May die Äußerlichkeit des zur Wandlung führenden Prozesses erkannte und noch schnell einen "ideellen" Grund hinzufügte (80).
Die in 'Babel und Bibel' gebotene Lösung wäre ohne diesen Zusatz konsequenter gewesen: Die Überwindung des Gewaltmenschen durch Einwirkung auf seine äußeren Verhältnisse entspräche eher der durch mehr äußerliche Methoden (Härte und Strenge in der Geisterschmiede) gekennzeichneten alten Menschheitsseele (der Zusatz ließe sich allenfalls als erstes Anzeichen für den Wandel der Menschheitsseele rechtfertigen). Die "unvermischte" Lösung ist m.E. aber vorzuziehen, da sie realistischer ist. Das Drama böte mit ihr nämlich eine Alternative zu den Brechtschen Lösungen an: Brecht läßt den Gewaltmenschen siegen, aber er verfolgt damit die Absicht, das Publikum über die Hintergründe der Überlegenheit des Gewaltmenschen aufzuklären, damit dieser dann vom Publikum besiegt werden kann. Was Brecht der Reflektion des Zuschauers überläßt, stellt Karl May dar: Der Gewaltmensch kann besiegt werden, wenn die äußeren Verhältnisse entsprechend verändert werden. Leider wird diese Erkenntnis nicht im Rahmen zeitgemäßer Wirklichkeit dargestellt (wie bei Brecht) sondern im luftleeren Raum der mystisch-religiösen Konstrukte mayscher Weltanschauung, so daß der Wert der von May gebotenen Lösung wieder aufgehoben wird.
Mays Behauptung, sich in 'Babel und Bibel' nicht an "europäischen Kunstgesetzen" orientiert zu haben, wurde schon angeführt. Die ungewöhnliche zweiaktige Form schien das zu bestätigen. Der innere Aufbau erwies sich dann allerdings doch als stark am klassischen Drama orientiert. Neu war aber der Versuch, das Schema des klassischen Dramas auf jeweils einen Akt anzuwenden, um das Erreichen eines Zieles in zwei Schritten darzustellen. Es wird dadurch ein retardierendes Moment in die Handlung eingeführt, das bei Entschlüssen in der Wirklichkeit ja häufig anzutreffen ist: Der Mensch ist im allgemeinen nicht sehr entschlußfreudig, gibt nicht so leicht eine "eingefleischte" Meinung auf, zumal, wenn sie in Übereinstimmung mit der altgewohnten Umgebung, mit dem überkommenen Recht und der herrschenden Religion steht. Eine solche, gefestigte Haltung zeigt die Tendenz, sich - wenn sie von einem Angriff getroffen wurde - erneut zu konstituieren. Einem zweiten Angriff ist sie dann aber nicht mehr gewachsen. Hier also "stimmt" Mays Psychologie.
Die Ausführung dieser Idee ist May allerdings nicht gelungen. In seinem Bemühen, zum Schluß jedes Aktes Haupt- und Nebenhandlungen zusammenzuführen, hat er die gut aufgebaute Haupthandlung zu stark gestört. Im
| 80) | Daß May hierfür auf das Motiv der überraschenden Freilassung des Feindes zurückgriff, mag seinen Grund darin haben, daß dieses Motiv zu den Standardmotiven seiner Reiseromane gehört (er hat es eindringlich(er) und überzeugend(er) z.B. in der Aschyk-Episode des "Silberlöwe" IV eingesetzt.). |
ersten Akt gewinnt das Schattenspiel gegenüber der viel wichtigeren Erzählung von der Geisterschmiede ein zu starkes Gewicht durch die Schlußstellung. Und der ganze Schluß des 2. Aktes (ab 13. Auftritt) wird durch ständiges Auf- und Abtreten und durch die eingeschobenen "Erkennungsszenen", auch durch Elemente, die dem "Zwischenspiel" zugehören, derartig verzettelt, daß (zumindest beim Lesen) der Eindruck eines großen Durcheinanders entsteht.
Die Frage nach überzeugender Darstellung des im Drama behandelten Problems ist schon bei den vorangegangenen Bemerkungen zur "neuen Form" und zum "neuen Inhalt" mit berührt worden. Auch die Anmerkungen zu der nicht befriedigenden Vermittlung des symbolischen Gehaltes der Figuren Marah Durimeh und Vorbeter gehören mit zur Beantwortung dieser Frage. Trotz der aus den vorangegangenen Untersuchungen folgenden negativen Vorbelastung sei dieser Frage aber noch weiter nachgegangen: Überzeugende Darstellung bedeutet nämlich über die Schlüssigkeit des Inhaltes und über die akzeptable Form hinaus, daß der Autor sich die Aufmerksamkeit und das Interesse des Publikums durch spannungegeladene und farbige Szenen sowie durch die Zeichnung starker Charaktere erhalten muß, bis der Vorhang fällt.
Zunächst zu den Charakteren: Von den Nebenfiguren sind der Hakawati, der Kadi, der Imam und. Babel bühnenwirksam gestaltet; einmal durch gelungen typisierte und farbige Zeichnung ihres Äußeren und zum anderen durch die jedem an exponierter Stelle des Werkes anvertraute große Rede. Die Reden des Imam und Babels zählen zu den dramatischen und sprachlichen Glanzpunkten 'Babel und Bibel's. Bent'ullah und Marah Durimeh dagegen gewinnen keine Kontur (der erste Auftritt des 2. Aktes, der ihnen vorbehalten ist, ist der farbloseste des ganzen Stückes), sie bleiben blasse Schemen, deren Funktion im Stück zudem recht unklar bleibt (der Scheik der Todeskarawane hätte gut alles allein "regeln" können). Der Vorbeter (zugleich die Botenrolle das Stückes) wird wegen der schlechten Behandlung durch Abu Kital. gewiß die Sympathie und das Mitleid der Zuschauer erlangen, wodurch aber seine Rolle im Stück unangemessen aufgewertet wird. Die Figur Schefaka ist ziemlich verzeichnet; einmal durch das manchmal recht alberne Gehabe, das ihr zugeschrieben wurde, zum anderen wegen ihrer Funktionslosigkeit (sie wird eigentlich nur als "Kleiderständer" im "Zwischenspiel" des 1. Aktes gebraucht).
Die beiden Hauptakteure des Stückes jedoch sind May rundum gelungen. Der Scheik der Todeskarawane, der durch sein zerlumptes Äußere schon Aufmerksamkeit und Teilnahme erregt, dürfte die Person des Dramas sein, mit der- vor allem wegen der großartigen Szenen der Konfrontation mit Abu Kital im 1 und 2. Akt - der Zuschauer sich identifizieren wird. Er ist als Edelmensch wie als Scheik glaubhaft gezeichnet.
Mit Abu Kital endlich hat May eine Bühnenfigur geschaffen, die als "Saft- und Kraftmensch" (May) dem Brechtschen Puntila durchaus vergleichbar ist. Abu Kital steht (außer zu Beginn des 2.Aktes und in 3 kleinen Auftritten) während des gesamten Stückes auf der Bühne und - wenn er nicht gerade mit dem Scheik der Todeskarawane zusammentrifft - beherrscht die Szenerie mit seiner kraftstrotzenden, impulsiven - aber auch herzlichen Art. Die Sympathie des Publikums wird wohl durch die Behandlung des Vorbeters geschmälert, durch die Szenen der Erinnerung an Bent'ullah und durch den Schlußauftritt den 1. Aktes wird sie ihm aber erneut voll zufließen. Die eindrucksvolle Charakterisierung Abu Kitals wird allerdings schwächer im - ohnehin mißratenen - Schluß des 2. Aktes. Dort ist er mir zu rasch mit allem einverstanden (ging es etwa schon zu sehr auf die tausendste Verszeile zu?!): Die hier dargestellte "innere Größe" wäre eindrucksvoller, und es wäre dem Charakter Abu Kitals angemessener, wenn ihm auch in der Niederlage etwas mehr äußere Festigkeit gegeben wäre.
Fazit: Die überzeugenden Charaktere in 'Babel und Bibel' tragen überwiegend die äußere Handlung, während der Bereich der Menschheitsseele, der die symbolische Handlung des Werkes tragen müßte, nur im Hakawati und im
Scheik der Todeskarawane (dessen große Szenen aber ebenfalls mehr der äußeren Handlung zuzurechnen sind) akzeptabel besetzt ist.
Nicht viel anders sieht es in Bezug auf die "spannungsgeladenen und farbigen Szenen" aus: Es gehören dazu die beiden Beratungen, die beiden Hauptszenen des Scheiks der Todeskarawane und auch das "Zwischenspiel" des 1. Aktes: Bis auf diese letzte und die Erzählung von der Geisterschmiede also wiederum in der Hauptsache Szenen, die primär der äußeren Handlung angehören.
Durch eine Vorlesung Prof. Dr. H. Röllekes an der Universität Köln (über Märchen) wurde ich auf die Thematik 'Gottähnlichkeit' aufmerksam gemacht, die in 'Babel und Bibel' auch anklingt:
Mays Drama reiht sich in die den Kampf zwischen Edelmenschen und Gewaltmenschen thematisierende Literatur ein. Aber 'Babel und Bibel' hat auch teil an der Literatur, die den Ursprung dieses Konfliktes, die Ursache der Spaltung der Menschheit in zwei Lager behandelt. Aus religiöser Sicht (und nur diese steht hier zur Debatte) läßt sich der Konflikt zurückführen auf die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des Bibelwortes "Lasset uns den Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei" (l. Moses 1,26). Doch was heißt 'Gott gleich sein'? Der erste, der das falsch auslegte, war Luzifer. Seine Interpretation trotz härtester Bestrafung weitergebend, verursachte er die Spaltung der Menschheit in Gewalt- und Edelmenschen: "Da aber sprach die Schlange zum Weibe: ... ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, daß von dem Baum gut zu essen wäre ... und verlockend, weil er klug machte." (l. Moses 3,5 f.) Auch hier folgte der falschen Auslegung grausame Bestrafung. Falsche Interpretation des göttlichen Wortes ist also: gottähnlich werden wollen im Einblick auf Allmacht und Allwissenheit, um Vorteile im irdischen Leben zu gewinnen. In der Literatur wird diese Denkrichtung dargestellt beispielsweise im Märchen 'Von dem Fischer un syner Fru' (Paradebeispiel), in Goethes 'Faust' ("Ich Ebenbild der Gottheit ... Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft" I, Nacht) - und in 'Babel und Bibel': der Name An'allah bedeutet 'Ich bin wie Gott' (F 142 / B 202). -Die An'allah erweisen sich unter diesem Gesichtspunkt als die 'Ur-Gewaltmenschen'. Hier kann man, glaube ich, May getrost geniale Konzeption bescheinigen. Die Denkrichtung der An'allah - sprich Gewaltmenschen - wird vom Imam in seiner Rede im 2. Akt eindringlich dargestellt und gegen die christliche Weltanschauung abgegrenzt (gegen das WAHRE Christentum!).
Bezüglich der Interpretation des Begriffes Gottähnlichkeit repräsentiert die christliche Weltsicht das ('richtige') edelmenschliche Denken: Gott ähnlich werden wollen, heißt Streben nach ethischer Vollkommenheit. So schreibt Paulus "Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist." (Kolosser, 3,2: Vgl. dazu die Worte der Phantasie: "Du mußt die Erde aus der Höhe schauen, / Denn nur nach dort hinauf zeigt sie sich wahr" (F 7193 / B 239) und "Belüget einander nicht; denn ihr habt ja ausgezogen den alten Menschen mit seinen Werken und angezogen den neuen, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbilde dessen, der ihn geschaffen hat." (Kolosser, 3,9 f.: Vgl. Entkleidung der Seele und Designierung- Abu Kitals). Bei Thomas von Aquin endlich findet sich: "Gottes Macht ist sein Gutsein. Darum kann er seine Macht nicht anders denn gut gebrauchen. Das ist bei den Menschen nicht zu finden. Darum genügt es nicht zur Glückseligkeit, daß der Mensch Gott ähnlich werde in der Macht, es sei denn, daß er ihm ähnlich werde im Gutsein. " (Summa theologica I, II. 2,4 ad 1).
Die diesem Denken entsprechende Literatur ist die Legende. Die Verbindung der Werke Karl Mays zur Gattung der Legende wies Gunter G. Sehm (im Jb-KMG 1976) nach- "'Heldische Bewährung mit dem Ziel der Gottverähn-
lichung'" (S. 25) ist auch grundlegendes Strukturelement der Old Shatterhand/Kara Ben Nemsi-Geschichten.
Versucht man, Mays Symbolik unter Zugrundelegung der Untersuchung Sehms aufzuschlüsseln, ergäbe sich: Old Shatterhand/Kara Ben Nemsi der Reiseromane vor 1899 repräsentieren den 'Heiligen' in seinen 'Lehrjahren': mit recht irdischen Mitteln Frieden erzwingend; Kara Ben Nemsi a1s 'Menschheitsfrage' (nach 1899): Der 'Heilige' auf dem Höhepunkt seines Wirkens: als waffenlos zum Frieden erziehender Gesandter der Menschheitsseele. Ben Tesalah ist Zwischenstation: Zwar waffenlos, aber doch mit recht starkem äußeren Druck arbeitend. Marah Durimeh/Bent'ullah sind dann als Engel einzuordnen: gewissermaßen die Schutzengel der Menschheit.
Daß der Mir von Dschinnistan als Gottessymbol gelten kann, hat Sibylle Becker a.a.O. - Anm. 117) einleuchtend dargelegt (die dagegen sprechende, Stelle (daß der Mir unter dem ganz besonderen Schutz Marah Durimehs stehe) dürfte als Irrtum Mays anzusehen sein.
Mit dieser Arbeit sollte - im Anschluß an Arno Schmidts These - untersucht werden, ob das für die "Silberlöwe"-Bände III und IV und den 'Mir von Dschinnistan' geforderte Prädikat 'hochliteraturverdächtig' auch dem ebenfalls dem Spätwerk zuzurechnenden Drama 'Babel und Bibel' zukommt. Ohne näher darauf einzugehen, was "hochliteraturverdächtig" eigentlich heißt, kann gesagt werden, daß 'Babel und Bibel' nicht zu den bedeutenden Werken dramatischer Literatur gehört. Eine Aufführung auf großer Bühne halte ich vor allem wegen der unzureichenden inneren und äußeren Darstellung des Problems (aber auch wegen des mystisch-religiösen Weltbildes, das vorgestellt wird) für wenig erfolgversprechend. (81)
Aber die unbestreitbar vorhandenen Positiva des Werkes sollten auch nicht unberücksichtigt bleiben: Eine geschickte dramaturgische Bearbeitung könnte das Stück für Experimental- und Studiobühnen oder für Laien- und Schülertheatergruppen interessant machen. Für diese Gruppen ist. das Stück schon deshalb ideal, weil es unaufwendige Ausstattung (nur eine Dekoration) und relativ geringe (außer bei Abu Kital) schauspielerische Fähigkeiten verlangt.
Bei dieser Wertung wurde die Verflechtung der verschiedenen Lese-Ebenen nicht mit berücksichtigt. Der Theaterbesucher verfügt nicht über die speziellen Vorkenntnisse, diese Verflechtung zu erkennen. Für die Karl-May-Forschung ist 'Babel und Bibel' wichtig durch seine Beziehung zum 'Mir von Dschinnistan': 'Babel und Bibel' ist Vorstudie für den großer. Roman; was dort in epischer Breite überzeugend dargestellt wird, findet sich in nuce im Drama vorgezeichnet.
| 81) | Dadurch, daß eine "große Bühne" sich mittlerweile des dramatisierten 'Waldröschen's angenommen hat, wird mein Urteil zwar nicht revidiert, aber die Hoffnung auf eine repräsentative Welturaufführung von 'Babel und Bibel' scheint mir nicht mehr ganz so abwegig wie vorher. Im übrigen verweise ich bezüglich der Frage, ob Mays Drama theatertüchtig sei, auf das Nachwort von Hansotto Hatzig. |
Es sei mir gestattet, mich ganz persönlich und subjektiv auszudrücken.
Bernhard Kosciuszkos Analyse von Mays einzigem vollendeten Bühnenstück ist gewiß die am weitesten fortgeschrittene Arbeit, die bisher zu diesem Thema geleistet wurde. Umso größer war meine Enttäuschung, daß der Verfasser, was eine Aufführung des Stückes betrifft, nur eine Lösung vorzuschlagen wußte, die - meiner Meinung nach - das Stück noch weiter ins "Abseits" führen könnte. Das liegt wohl daran, daß Literatur und Theater eben doch nicht unbedingt dasselbe sind. Kosciuszko ist Literaturpraktiker. Aber das ist eine andere Sache und hat mit Theaterpraxis nur bedingt etwas zu tun. Es ist eine alte Erfahrung, daß sogar der Schauspieler zwar in seine Rolle aus einem neuen Stück durchaus schon "verliebt" sein kann, obwohl er von der Realisierung des Stückes auf der Bühne noch gar keine Vorstellung hat. Für Laien- und Schüleraufführungen gilt jedoch, daß sie mit Volksstücken und Klassikern die besten und berechtigten Erfolge haben. Bei den Volksstücken - ich möchte beispielsweise 'Preziosa' von Pius Alexander Wolff, worin May einst als Trommler mitwirkte, nennen - ist das wegen der Unkompliziertheit klar ersichtlich. Bei den Klassikern liegt es hingegen daran, daß der Zuschauer schon eine gewisse Vorstellung hat von dem, was er zu sehen bekommt, sei es von Shakespeare, Schiller oder Molière, und es als interessant empfindet, wie "normale Menschen", also Laien oder Schüler, das machen. Aber ein neues, noch nicht bewährtes Stück gehört meiner Meinung nach in die Hand von Theaterpraktikern; sie allein sind imstande, ein solches Projekt durchzusetzen, falls es überhaupt durchsetzbar ist. Erst wenn das geschehen ist, können sich Schüler und Laien erfolgreich damit befassen.
Leider hat die Theaterwelt sich bisher kaum mit 'Babel und Bibel' beschäftigt. Mir sind bisher nur zwei Stimmen von Theaterpraktikern bekannt, die ich hier anführen möchte. Die erste ist die unseres verehrten May-Freundes, des Burgschauspielers Amand von Ozoroczy, der in der Augsburger Postzeitung vom 28.7.1907 wie folgt schrieb:
"Den Riesenstoff hat May mit ungewöhnlicher Selbstzucht in 2000 Verse geprägt, die rein und edel, ohne Spur von Überladung, wie klares Gewässer dahinrauschen. Die Versuchung zu epischer Breite hat May mit überraschendem Geschick bekämpft, die Besonderheit der Technik war von vornherein durch die Auffassung als Fantasia gegeben. in das ernste Gemälde trägt Schefaka, das 'Schreckenskind', einige heitere, frohe Farben, und Szenen, wie etwa auf Seite 74, 113, 116 müßten von der Bühne herab zünden wie nur je May'scher Humor gezündet hat. Des Dichters eigene Züge können wir wohl in dem alten Märchenerzähler begrüßen, bei dem die Phantasie zu Gaste ist und ihm seine Lieblingssage endlich zur Wirklichkeit macht. 'Seltsam ist Propheten Lied, / Doppelt seltsam, was geschieht ... '
Der alte Erzähler, der in seiner oft entzückend treffsicheren Dialogführung schon dramatisches Blut verriet, würde auch auf der Bühne bestehen. Freilich könnte sich nur eine Bühne allerersten Ranges an die Darstellung wagen. Das Burgtheater in Wien hätte in Josef Kainz einen kongenialen Interpreten für den Abu Kital, mit dem das Stück steht und fällt."
Karl May hat den genannten Josef Kainz übrigens mehrmals - auch als Hamlet - auf der Bühne bewundert.
Als zweite Stimme kann ich leider nur meine eigene darbieten, die sicherlich nur bescheidenes Gewicht hat, sich aber immerhin auf Schauspielstudium und Theaterpraxis stützen kann. Ich zitiere aus meiner Monographie 'Karl May und Sascha Schneider', Bamberg 1967, Seite 135:
"Niemals hat May sich von einem seiner Werke mehr versprochen als von seinem ersten Bühnenstück - von den Bühnenstücken, die er schreiben wollte, überhaupt! Diese Hoffnung wurde zur bittersten Enttäuschung. Niemals wurde 'Babel und Bibel' aufgeführt. Dabei hätte das Stück unter den Händen von Max Reinhardt, der damals die Tragödien der Antike mit neuem Leben erfüllte, einen achtungsvollen Erfolg haben können. Heute wäre Fritz Kortner der
geeignete Regisseur, um das Stück überzeugend auf die Bühne zu bringen. Die obligaten Buh-Rufe sind ihm ja sowieso gewiß, ob er sich nun mit seiner Inszenierung engagiert oder ob er nur handfestes Theater bietet! Denn das war Mays Absicht: mit neuen Formen und neuen Ideen von der Bühne herab zu wirken. Schiller und Lessing, von Klara May als seine 'Lieblingsklassiker' bezeichnet, standen zweifellos deshalb so hoch in seiner Gunst, weil er in ihnen die Wegbereiter eines Theaters als moralische Anstalt sah. Das Erstaunliche ist jedoch: 'Babel und Bibel' ist nicht das Stück eines späten Nacheiferers Schillers oder Lessings. Wollschläger rechnete es bereits zur 'Jedermarnn-Kategorie'."
Ab hier möchte ich neu formulieren. Denn auch, was Hofmannsthals 'Jedermann' betrifft, bleibt Kosciuszko allzusehr im Literarischen stecken. Meiner Ansicht nach meint Wollschlägers These vor allem auch die äußere Form, die Loslösung von der "Guckkastenbühne", die Möglichkeit, das Stück allüberall darbieten zu können, vor dem Hintergrunde von Ruinen, auf Kirchentreppen und in Kirchen selbst. Ich habe als "Prolog" fast fünfzig Jedermann-Aufführungen auf Kirchentreppen eröffnen dürfen und war mehr als zehnmal als "Jugendfreund" bei Hofmannsthals 'Der Tor und der Tod' dabei. Deshalb meine ich, man sollte die "Jedermann-Kategorie" nicht allein auf den inneren Gehalt beziehen, sondern auch die äußere Möglichkeit, die praktische Verwirklichung des Stückes mit berücksichtigen. Ob allerdings Karl May selbst schon in dieser Richtung gedacht haben mag, dafür gibt es bisher keinen Beleg.
Zum Schluß möchte ich Bernhard Kosciuszko zitieren: "Wer recht haben wird, das zeige uns die Praxis, auf die wir alle mit Ungeduld warten."
Zum folgenden Faksimile:
K a r 1 M a y i n ' L i t e r a r i s c h e S i 1 h o u e t t e n '
Den "Probebogen aus 'Literarische Silhouetten'", wie er von Mays eigener Hand bezeichnet wird (Seite 34), stellte uns freundlicherweise Anton Haider, Pettnau, aus seinem Archiv zur Verfügung.
Die Titelseite zu dem im Jahre 1907 erschienenen "literaturkritischen Jahrbuch" verdanken wir Heinz Neumann, Bietigheim, der den Band im Literatur-Archiv Marbach einsehen konnte. Der May-Text des "Probebogens" findet sich darin auf den Seiten 173-179 unverändert, sogar mit dem Druckfehler "Nitzsche" (Seite 10 des Probebogens; Seite 179 des Bandes).
In der zweiten Ausgabe der Literarischen Silhouetten (Mai 1907) heißt es im Vorwort, daß es "Zweck des literarischen Schriftsteller-Jahrbuches" sei, "für die zeitgenössischen Dichter und Denker und ihre Buchwerke Propaganda zu machen". Es werde, "nachdem es in kurzer Zeit seine Lebensberechtigung erwiesen ... regelmäßig alljährlich im Februar erscheinen."
Wie Heinz Neumann ermittelte, ist May in dieser zweiten Ausgabe nicht mehr enthalten Es folgt MAYER PROF DR. ADOLF (Heidelberg), geb. 1843, auf MATTHES, OTTO (Sommerfeld), geb: 1845, der auch schon in der ersten Ausgabe zu finden war, dort gefolgt von MATTHIES, CARL (Rixdorf-Berlin), geb. 1877, MAY, KARL (Radebeul-Dresden), geb. 1842, und MEISEL-HESS, GRETE (Wien), geb. 1879.
Die "Dichter und Denker" wechselten also teilweise in den einzelnen Ausgaben oder Auflagen. Karl May ist nur in der ersten Ausgabe erschienen. In der 4. Auflage, vom Jahre 1909, ist er, wie Heinz Neumann feststellen konnte, ebenfalls nicht mehr enthalten.
und
(Ausgabe 1907)
(früher Schriftleiter der "Internationalen Literaturberichte").
Literaturwissenschaftlicher Verlag B. Volger
(Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.)
1907.
H e r a u s g e g e b e n u n d b e a r b e i t e t
von
Dr. philos. Heinz Voss
und
Dozent a. D. Bruno Volger

Oetzsch-Leipzig

| Mannheimer, Theodor, Karl (Wien IV/2, Heugasse 52) 1875 geboren; Realschule, Handelsakademie, Sprach- und Literaturstudien, Nationalökonomie; Artillerie-Leutnant d. R. Bücher: In Lust und Leid; Ekstasen und Reflexionen; im Erscheinen: Gereimte Humoristika. Die Gedichte "In Lust und Leid" schon zeigen, dass wir es mit einem starken lyrischen Talent mit ausgeprägt eigener Note zu tun haben. Was der Dichter gibt ist echtes Gefühl, ist Ausfluss eines lebhaft, tief, innig und poetisch empfindenden Gemüts. Mannheimers Vorzüge sind: Klare Wiedergabe selbst zarter Empfindungen, gedanklicher Reichtum, schwingender Rhythmus, fast durchweg prächtige poetische Form, Schlichtheit. Wo er leidenschaftlich ist, ist er kräftig und packt; in der Stimmungsmalerei ist er ebenso sicher als duftig; er kann sich aber, und tut es oft, bis zur Ekstase steigern. Im Ausdruck ist er korrekt bei rühmenswerter Kürze; sein Sprachschatz ist ein reicher, klingender. Welche kernige, bündige Wahrheit liegt im folgenden "Ich leb im Land der Leidenschaft": |
| Ich leb im Land der Leidenschaft Ein eignes, echtes Leben, Ich leb in Lieb, die nie erschlafft Dir, Traute, treuergeben; Und unsrer Lieb, wildwonniglich Ist all mein Glück entsprossen Und fahr dereinst zur Grube ich, So hab ich hold genossen. |
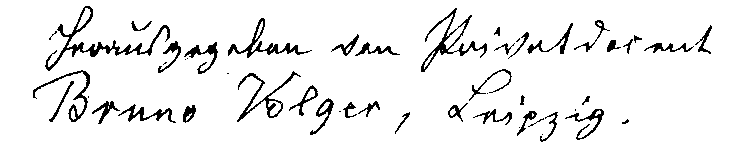
"Neuen Gemeinschaft" nach Schlachtensee über, lebt später als Schriftsteller in Berlin, Neuenburg (in Oldenburg) und Offenbach a./M. Seit Oktober 1905 ist Carl Matthies Redakteur der "Monatshefte für graphisches Kunstgewerbe (Berlin)". Sein Hauptwerk ist das Gedichtwerk " W a l p u r g i s " , über welches unter anderen Kritikern der Dichter Heinrich Hart urteilte: Eine ungewöhnliche Gestaltungskraft, die noch Bedeutendes verheisst, spricht aus den beiden poetischen Sonaten, die Carl Matthies beigesteuert hat. Alle Stimmungen, vom Zierlichen und Heiteren bis ins Grosse, Gewaltige bemeistert er hier mit erstaunlicher Sicherheit. Aber auch seine übrigen Lieder und Gedichte durchströmt ein inbrünstiges Empfindungsleben, das alles, was da ist, zu umfassen und zu durchdringen sucht, und schon heut, wenn auch nicht ausnahmslos, sich künstlerisch in fast vollendeter Weise offenbart.
Zahlreiche Gedichte, Skizzen, Essays und Kritiken erschienen in den verschiedensten Zeitschriften; etliche der Gedichte sind von E r n s t S c h a u s s vertont worden.
Durch Matthies Dichtungen weht eine tiefe Melancholie, ein schwerer Ernst, sie verraten, dass ihm Kampf und Sturm treu waren und sind. Besonders muss hervorgehoben werden die Plastik der Sprache und geistige Höhe alles dessen, was er in Reime giesst.
May, Karl (Radebeul-Dresden, Villa "Shatterhand"), geboren 1842 in Hohenstein-Ernstthal als Sohn armer Webersleute. Besuchte zwei Seminare,
wurde Lehrer, dann Schriftsteller und bildete sich auf autodidaktischem Wege weiter. Seine eigentliche Domäne ist das Studium des sog. "inneren Menschen". Literarisch einen Weltruf geniessend durch seine 30 Bände Reiseerzählungen mit im Grunde metaphysischer Bedeutung sind diese doch nur als Vorübungen zu seinen eigentlichen Werken zu betrachten, von dem erst eins " B a b e l u n d B i b e l " vorliegt. Das scheint ungewöhnlich, ist aber so. Seine bisherigen Werke enthalten, wie bekannt, nur den unbearbeiteten Stoff, die Vorübungen, Etuden und Szenen zu seinem neuen, eigentlich-dichterischen Schaffen.
Wie schon in diesen Vorübungen den sogenannten "Reiseerzählungen", so geht Karl May auch in seinem ersten wirklichen Werke seinen eigenen Weg. Er macht es einem zwar leicht genug, zu folgen, aber man befindet sich auf unbekanntem Grund und Boden und hat mit seinem Urteil vorsichtig zu sein. Schon in Beziehung auf die äussere Technik weicht der Dichter von den geltenden Gesetzen ab, indem er den Spielabend mit nur zwei Akten und einer dazwischen liegenden längeren Pause füllt. Das Stück gibt die Ereignisse eines halben Tages, von nachmittags drei Uhr bis Mitternacht drei Uhr. Es spielt in beiden Akten vor dem Riesentore des babylonischen Turmes und erfordert nur eine einzige Dekoration. Auch in Beziehung auf die innere Technik geht er seinen Weg. Er richtet sich z. B. nicht nach bekannten dramatischen Regeln, sondern er lässt die Handlung vom Anfang bis zum Ende in grader Linie und immer
stärker werdender Spannung emporsteigen und krönt das Ganze dann mit einem Schlusse, der so hoch liegt, dass man meint, von ihm aus die kommenden Jahrtausende überschauen zu können. Es mag das kühn sein, aber es stimmt mit dem Bilde, welches wir aus seinen Vorstudien und Skizzen von ihm gewonnen haben, und mit dem gewiss sehr furchtlosen Motto welches er seinem Drama an die Spitze gestellt hat:
| "Gott schrieb die Schöpfung nicht ab Trauerspiel: Ein tragisch Ende kann es nirgends geben, Zwar jedes Leben ringt nach einem Ziel, Doch dieses Ziel liegt stets im nächsten Leben. |
Indem wir durch dieses Motto auf den Inhalt des Stückes geführt werden, tritt uns diese Furchtlosigkeit des Verfassers in fast noch höherem Masse entgegen. Denn es ist wirklich kühn, gleich in der ersten Szene den drei fliegenden Worten "Amerika nur für Amerika", "Der gelbe Osten für die gelbe Rasse" und "Europa, wahre deine heil'gen Güter" die strikte Antwort des Orientes entgegenzustellen "Das Morgenland nur für das Morgenland"! Und es deutet auf eine ungemeine innere Selbständigkeit, wenn ein Dichter es wagt, die "Phantasie", die "Menschheitsseele", den "Geist des Morgenlandes", den "Geist des Abendlandes" und ähnliche nur gedachte Wesen zu personifizieren, um sie auf die Bühne zu bringen. Aber er tut das in einer. Weise, als ob das ganz Gewöhnliches, Natürliches, sich von selbst Verstehendes sei; ergibt diesen imaginären Wesen die greifbarsten
Gestalten, die man sich denken kann, und er erreicht damit Wirkungen, die jedem, der diesen Mut nicht besitzt, versagt bleiben müssen. Dass es Karl May gewiss nicht eingefallen, sich mit dem von ihm gewählten Titel auf den bekannten, leidigen Babel-Bibel-Streit zu stützen, ist eigentlich überflüssig besonders zu betonen. Die Karl May'sche Dichtung hat mit religiösen Streitfragen nichts zu tun. Ihre Aufgabe ist eine rein menschliche. Sie soll zeigen, warum und in welcher Weise sich der "Gewaltmensch" zum "Edelmenschen" zu entwickeln hat, und es entspricht ganz und gar der Gesinnung des Verfassers und dem Inhalt aller seiner bisherigen Veröffentlichungen, dass er diese Veredelung auf dem biblischen Wege des Leidens und des Kampfes gegen sich selbst geschehen lässt. Vorauszusehen war, dass er auch hierbei, wie bei allen seinen Vorarbeiten, darauf verzichtet hat, die geschlechtliche Liebe mit heranzuziehen; er fühlt sich unabhängig genug, auch im Drama auf sie verzichten zu können, zumal in einem Drama dieser vollständig neuen Art, wo alles Geschehen nur seelisch und geistig zu denken ist.
Und hiermit kommen wir zum Schluss auf die bekannte Eigenart des Dichters den Leser und Hörer ganz unbemerkt aus der sinnlichen Welt in die Welt der Ideale hinüber zu führen und alles, was die Gegenwart versagt, von der Zukunft zu erhoffen. Diese Eigenart ist sowohl künstlerisch als auch literarisch sehr wohl berechtigt, denn die Wahrheit liegt nicht bloss in der Materie, sondern sie geht
hoch über sie hinaus. Das May nach diesem Jenseits strebte, war kein Fehler, sondern ein Verdienst von ihm. Und wenn er uns in dem vorliegenden Drama die Tore desselben öffnet, so dass wir in eine für uns neue, herrliche, von Liebe, Glück und Frieden überstrahlte Welt zu blicken vermögen, so können wir nur wünschen, dass die Zahl derer, die mannhaft genug sind, mit ihm und nach ihm denselben Weg zu gehen, sich nicht vermindern sondern vermehren möge. Es ist somit "Babel und Bibel" ein Drama hohen, ernsten Stils. Das Milieu ist echt morgenländisch. Die Wirkung ist eine tatsächlich gewaltige; auf der Bühne wird sie eine erschütternde sein, zugleich eine erhebende, klärende und beseligende. Die Bühne, die sich die Uraufführung sichert, hat das Recht von einer Tat zu sprechen, sie wird auch einen grandiosen Erfolg notieren dürfen!
Mays "Reiseerzählungen" umfassen 30 Bände und zwar: Durch die Wüste; Durchs wilde Kurdistan; Von Bagdad nach Stambul; In den Schluchten des Balkan; Durch das Land der Skipetaren; Der Schut; Winnetou, 3 Bde.; Orangen und Datteln; - Am stillen Ocean; Am Rio de la Plata; In den KordilIeren; Old Surehand, 3 Bde.; Im Lande des Mahdi, 3 Bde.; Satan und Ischariot, 3 Bde.; Auf fremden Pfaden; Weihnacht; Am jenseits; Im Reiche des silbernen Löwen, 4 Bde. sowie Und Friede auf Erden. Der Dichter und Denker May wird oft in landläufigem Sinne als Jugendschriftsteller bezeichnet. Das ist falsch, denn das ist May nicht. Richtig ist, dass er
für die s e e l i s c h e und für die g e i s t i g e Jugend schreibt, die nie alt werden kann, für eine andere schrieb May keine Zeile. Es mag hier angefügt sein, was über May in dem Nachschlagewerk "Bildende Geister", völlig zutreffend, zu lesen ist: "Das vierbändige Werk "Im Reiche des silbernen Löwen" enthält einen psycho-biographischen Versuch über sein bisheriges inneres Leben. In dem Buche "Und Friede auf Erden" ist seine geistige Welt in kurzen, kräftigen Strichen angedeutet. Überhaupt sind seine sogenannten "Reiseerzählungen" zwar allerdings zunächst das, was der Titel sagt, in Beziehung auf ihren eigentlichen, tieferen Inhalt aber doch etwas ganz Anderes, vielleicht noch nie von irgend wem Geschriebenes. Vor allen Dingen ist es ihm niemals eingefallen, diese Bücher für die urteilslose, unerwachsene Jugend zu schreiben." Turmhoch stehen diese phantasie- und gedankenreichen Werke über der sogen. Indianer-(Jugend)erzählung! Im Hintergrunde all der starken ehrlichen Abenteuer steht eine ernste Lebensauffassung, ein sittlich hoher Wille, eine gründliche Kenntnis der geographischen und ethnographischen Wissenschaft, überhaupt ein fast polyhistorisches Wissen. Dabei verfügt der Dichter über an Handlung und Spannung selten reiche Schreibweise, wie neben ihm kein zweiter seinesgleichen, auch kein Romancierl Und das wunderbarste ist: "May" liest der reife Mann und der ernsthafte Tertianer - - die kluge Frau und der Backfisch. Niemand aber legte wohl je einen "May" unbefriedigt aus der Hand - -
Und nun - -nach all dem, nach dem Riesenerfolg steht dieser Sucher und Denker erst am Anfang seines eigentlichen Dichterwegs! Nitzsche hat für unsere Zeit zu früh gelebt - - sollte es auch bei Karl May so sein. Beides s i n d Geistestitanen - - so unendlich verschieden sie sind.
Meisel-Hess, Grete (Wien IX, Sechsschimmelgasse 9; Pseudonym: Diotima) geboren 1879, Schule bis zum 18. Jahre, dann Hospitantin an der Universität Wien, mit 21 Jahren verheiratet, Ehe geschieden. Seit ihrem achtzehnten Jahre literarisch tätig, erschienen seitdem teils mit Unterbrechungen, im allgemeinen aber regelmässig, Feuilletons, sozial-philosophische Artikel, Essays zur Frauenfrage, Novellen. Werke: In der modernen Weltanschauung; Fanny Roth, eine Jungfrauengeschichte (in 7. Auflage); Anni Bianka, eine Reisegesch.; Suchende Seelen, Novellen; Eine wunderbare Hochzeitsreise, Novelle; Weiberhass und Weiberverachtung, eine Erwiderung; D i e S t i m m e , Roman, ihr bedeutsamstes Werk. "Die Stimme" - das ist das Phänomen der künstlerischen Produktivität, des singenden Sinnes, der künstlerischen Ekstase. Die Schicksale solch einer "Stimme" (im Buch ist es eine Gesangstimme) sind in dem Werke geschildert. In einer Lebensgeschichte, die in Tagebuchblättern erzählt wird, erst memoirenartig, dann aber übergehend in die Wiedergabe gegenwärtigen Erlebens wird die Entwickelung der "Stimme", das Geheimnis ihres Tönens und Versiegens dargestellt. Auf dem Höhepunkt ihrer Kraft fallen die Produkte der Stimme
K a r l M a y s ' S k i z z e z u B a b e l u n d B i b e l '
Eine Vergleichslesung
Durch die Vergleichslesung, deren Ergebnis auf Seite 43 ff. aufgelistet ist, wird all denen, denen der seltene Jahrbuchtext nicht zugänglich ist, die Möglichkeit gegeben, auch diesen kennenzulernen.
Der Jahrbuchtext scheint mir aufgrund der typisch Mayschen Stilmerkmale (der letztere, der erstere, hat ... zu etc.) und der grammatischen, orthographischen und stilistischen Flüchtigkeiten (für die May sich entschuldigt) unbearbeitet zu sein. Einschübe der Herausgeber (Anmerkungen) wurden von diesen gekennzeichnet. Ich vermute, daß eine Abschrift oder das Original des Briefes an den Redakteur Abels der Edition zugrunde lag und das diese Textgrundlage handschriftlich war. Die Aufarbeitung des Textes für den Druck mag zwar Textveränderungen (unfreiwillig) verursacht haben, diese können aber gewiß als geringfügig angesehen werden.
Ich habe die gesperrt gedruckten Textstellen der Jahrbuch-Fassung in Großbuchstaben dem ungesperrten Bamberger Text gegenübergestellt. 'E-Differenen' (andere/andre, Dativ-e etc.), Orthographie- und Interpunktionsänderungen wurden nicht durchgängig berücksichtigt.
Digitaler Reprint des Sonderheftes 10
Karl Mays "Skizze" wurde bisher in zwei Textversionen veröffentlicht: Unter dem Titel 'Skizze zu Babel und Bibel' im Karl-May-Jahrbuch 1921, Radebeul, Seite 41-80 (Jahrbuch 1921) und unter dem Titel 'Erläuterung zu Babel und Bibel' in Karl Mays Ges.Werke Band 49, 'Lichte Höhen', Bamberg, hier: 82.Tsd., Seite 251-262 (Bamberg Bd. 49).
Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch l921 251/1 Erläuterung Skizze 2 Tatsachen Konkrete Tatsachen 7f hat er sein Zelt ... muß liegt sein Zelt so eng am Tor des Turmes, daß ein jeder, der in diesen will, an jenem vorüber muß 11 wie seine Frau als seine Frau 15 die Zuneigung des Bebliebtheit bei dem 19 anzustreben in die Wege zu leiten 5 Weib und seinen Sohn Weib und ihr Kind, seinen Sohn, 4 gingen, und Imam und Kadi entfernten sich, und der Imam und der Kadi 3 schriftliche Beweise die schriftlichen Beweise Vertriebenen Ausgeworfenen Anm a Karl May May Aufzeichnungen Skizze Schriftleiter Redakteur c/d Die Handschrift ...: Das Manuskript trägt von seiner Hand den Vermerk: 'In ... e Entwurf Konzept g - Die Herausgeber
//44//Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch l921 252/2 glücklich so glücklich 3 weiter ferner 9 Jungfrau Backfisch 15 einiger gewisser 18 die verstoßene Bent'ullah Bent'ullah 253/3 Besten Matador 4 des Schachs im Schach 10 nicht NICHT 13ff wanderte ... und geriet ist sie mit ihrem Sohn in der Irre umhergewandert und hat ihn in der Wüste verloren. Er wurde nicht von ihr, sondern von anderen gefunden und vom Schicksal in den Machtbereich von Marah Durimeh geleitet. 17 heilsame Schule nahm heilsame und erfolgreiche Schule nehmen ließ 18 Schnelligkeit Schnelligkeit empor 20 Vorschlag MDs Vorschlag von MD 21 wurde werden konnte 22 ge/funden gefunden und durfte sich nun einen festen Stamm wählen 9 Zwiespalt geschaffen Konflikt wohl vorbereitet 7 teilt ihr alles mit teilt ihr selbstverständlich alles mit 4 mag grausam mag dem gewöhnlichen Menschen grausam 1 größte Segen größte und allgemeinste Segen 254/7 aufzukeimen unterwegs zu sein 9 heiligsten Güter heil'gen Güter 10 erklingt's erklang es 20 sicheren Krieg bedeutet sicher Krieg 21 auf die An'allah Ueberfall der An'allah 23 zu tragen zu verlegen 25 auszuführen in die Wege zu leiten 26 ihm selber ihm selbst 7 ins feindliche in feindliches 3 dennoch Bedenken trüge dennoch irgendein Bedenken hätte 2 den kann man auf ... verweisen der ist auf das ... zu verweisen 255/1 ohne seine Ehre zu verletzen, seinem ... der seinem ... abhieb, ohne seine Ehre dabei zu verletzen 3 gerade diesen Entschluß grad diesen Entschluß 4 das seine Ausführung ungemein was seine Ausführung ganz ungemein 15 geritten GERITTEN 17 befehlen kommandieren 24 zu kommen bereit erklärt bereit erklärt, zu kommen 27f bei diesen hellen Jubel Das gab hellen Jubel bei diesen 6f würde erscheinen erschien 5 zum Ausspüren zur Spionage 4 brauchte man nur brauchte man ja nur
//45//Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch l921 256/1 um die Hilfe der benachbarten um die Beihilfe der um das Weidegebiet der An'a11ah gelegenen anderen Stämme 3 durchgeführt gehandhabt 7 andeutungsweise teilweise 8 und eingeladen und dann eingeladen 10 in der Überzeugung in der vollen Überzeugung 11 alle zusagen alle mit Freuden ja sagen werden 12 auf einem Eilkamel Boten mit Eilkamel 15 von fern umzingelt von ihnen fern umzingelt 17 nur der alte H. nur allein der alte H. 23 nennen sagen 24f sonst niemand sonst weiter niemand 25 die Folgen die vorauseilenden Folgen 6 Gegenplan Plan 1 - gewesen, nämlich beim 257/11 genauso genau so 14 davon hiervon 15 MD kommt, noch ehe sie Nämlich MD kommt, noch ehe sie öffentlichen ihren Öffentlichen 18 erscheint auch kommt ebenso auch 20 durchweg lauter 21 Der Einladung nach sollen beide Offiziell haben beide erst 22 erst morgen eintreffen morgen hier einzutreffen 24 werde, draußen im Sand werde, im Freien, da draußen in dem Sande 26 mit BT nebst BT 4 liefern bringen 258/2 Zweck aus, die An'allah Zweck aus, um die An'allah 5 Beute Eroberung 6 Pläne Aks Pläne des Scheiks AK 8 andern Stämme ... entscheiden anderen Stämme ... entscheiden werden. 10 Stamms Stammes 11 den andern Anführern bringt mit diesen Anführern zu bringen hat 12 erste Akt spielt ..., der zweite Die erstere erfolgt ..., die letztere dann um 13 Mitternacht, Mitternacht. Das gibt Gelegenheit, die Szene und das Milieu in der verschiedensten Beleuchtung erscheinen zu lassen. 14 vollen Erfolg einen vollen Erfolg 15 entflammt begeistert 16 so daß sie daß jedermann 18 schürt die Glut so gut treibt diesen Erfolg sogar so weit in die Höhe 19 allgemein der Ruf am Schlusse das allgemeine Geschrei erhebt 23 die gleiche ganz dieselbe 24f Ruf 'für die An'allah' aus Ruf aus, sagen aber nicht 'für das Morgenland', sondern 'für die An'allah' 8 wandelt verwandelt 5 zusammenbricht wie niedergeschmettert in sich zusammenbricht
//46//Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch l921 258/3vu stürzt auch schon das Verderben über ihn herein springt zu dieser Niederlage auch noch das aktive Verderben auf ihn ein die Krieger die herangeschlichenen Krieger 2 stürmen überrumpeln 259/2 tritt eine tritt sonst eine 5 Heimat ... den Vater Oertlichkeit ... seinen Vater 7 leichter verzeiht doppelt gern verzeiht 9f der Stämme ....bis ins kleinste der betreffenden Stämme in das Kleinste 10 geregelt entschieden
12 herrschen herrschen wird. 14f Metaphysisches, Symbolisches Metaphysisches und Symbolisches 16 Es hätte nah gelegen Es wäre nicht schwer gewesen 17 ein Trauerspiel zu gestalten eine Tragödie zu konstruieren etwas höchst Untragisches ETWAS HÖCHST UNTRAGISCHES 21 das Trauerspiel die Tragödie 25 Vorbestimmung usw. hinwegschreiten muß Präidestination usw. hinwegzuschreiten hat 26 sein Inneres sein eigenes Innere
260/5 daß ... könne DAß ... KÖNNE 6 verwandeln müsse ... Weg zu verwandeln habe ... Wege 7 Gottes- und Nächstenliebe Gottes- und der Nächstenliebe 8 geschehn geschehen 10 der andern Aufgabe der andern psychologischen Aufgabe 11ff nach dem. Menscchengeist ... verlorengegangen ist NACH DEM MENSCHENGEISTE ... IM LAUFE ... VERLOREN GEGANGEN IST 22 nach meinem Geist MEINEM GEISTE 23 meiner Seele MEINER SEELE 24f fliegt mir seine Seele zu, um sich fliegt mir, um sich finden zu lassen SEINE SEELE zu 27 Psychologie Psychologie (Anm. 5) 8 gröbste größte 2 eingepreßt! eingepreßt. 1 der niedrige Urtrieb die niedrige Anima. - Anm . 5): Mays Stellung zur Schulpsychologie kritisiert DR.A.DROOP in 'Karl May. Eine Analyse seiner Reiseerzählungen.' Köln-Weiden 1909, S. 172 ff. Jetzt: Karl-May Verlag. (Die Herausgeber)
261/1f hinaussehen ... hinaus/horchen ... hinausriechen heraussehen ... heraushorchen ... herausriechen 4 höchste Zeit allerhöchste Zeit 7 selber selbst 9f wahre Wissenschaft WAHRE WISSENSCHAFT 17 kostete (Anm. 1) Anm. fehlt 18 muß habe mich zu 19 darf höchstens darf nur höchstens 22 das menschlich Triebhafte die menschliche Anima 23 von da aus von dieser Anima aus 25 und zu meinem Winnetou und dem herrlichen Winnetou Anm -
//47//
Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch l921
262/3 genommen wissen möchte genommen haben möchte 5 zu deren erstem Teil zu deren ersten Teil 6f Umgestaltung Gestaltung Gewaltmenschen/Edelmenschen GEWALTmenschen/EDELmenschen 8 Anschauungsbüchern AnschauungsBÜCHERN 9 Anschauungsdrama AnschauungsDRAMA 20f nur darum, daß es eben Schneepflug werden möge! NUR DARUM, DAß ES EBEN SCHNEEPFLUG w e r d e n m ö g e ! 24 unsrer deutschen Volksseele UNSERER DEUTSCHEN VOLKSSEELE 27 Wissenschaft WISSENSCHAFT 9ff von ihm weg. Die Religion von ihm ab. Die RELIGION Dogmendienst Dogmenkultus irren Starrsinn irren Zelotismus Kunst KUNST der Geldgier der Mammonismus 5f Wissenschaft und Glauben WISSENSCHAFT und GLAUBEN einträchtige harmonische 1 und gewaltsam und so brutal
263/8 lediglich allein nur 12f vermitteln muß. Indem sie das tut, steigen alle drei! zu vermitteln hat. INDEM SIE DAS TUT, STEIGEN ALLE DREI! 14 der wahren Frömmigkeit DER WAHREN RELIGIÖSITÄT 15 des wahren Gottvertrauens DES WAHREN GOTTVERTRAUENS 16 des edlen Menschentums DER EDLEN MENSCHLICHKEIT 17 vernunftgemäßen Völkerfriedens VERNUNFTGEMÄßEN VÖLKERPRIEDENS 20f friedliche Versöhnung des Morgenlands mit dem Abendland FRIEDLICHE VERSÖHNUNG DES MORGENLANDES MIT DEM ABENDLANDE 27 wirklichen, der hohen, der heiligen Kunst WIRKLICHEN, der HOHEN, der HEILIGEN KUNST
264/1f gesunder Sinn Instinkt 7 möge wolle 10f Vorbildern Idealen 12 Vorbilder sind die ewigen, die alten Ideale sind die EWIGEN, die ALTEN 13 eu geboren werden NEU GEBOREN WERDEN 15 böse BÖSE (6) 18 belehren zu lassen! belehren zu lassen! Gebt uns andre Stücke, und gebt uns andre Vorbilder! GEBT UNS ANDERE STÜCKE, UND GEBT UNS ANDERE VORBILDER! 6 Bühnenleitern Intendanten 1 damit beginnen muß hiermit zu beginnen hat - - 6) Aufklärungsfilms!! (Die Herausgeber)
265/1 In dieser Erkenntnis Dieses erkennend 2f einen Anstoß zu geben einen hierauf bezüglichen Anstoß zu verleihen 3 mich gar aus gar mich aus 4 Bestbefeindete Bestbefeindetste 6 verwahren: gegen die verwahren, nämlich gegen die 9 Meine Zwecke sind rein MEINE ZWECKE SIND REIN 10f menschlich MENSCHLICHE Frömmigkeit Religiösität muß ich sie MUß ich sie
//48//
Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch l921
265/15f vor allen Dingen ein guter Mensch sein muß, um denken zu dürfen, man sei ein guter Christ! VOR ALLEN DINGEN EIN GUTER MENSCH SEIN MUß, UM DENKEN ZU DÜRFEN, MAN SEI EIN GUTER CHRIST! 17 Grundlage Basis 19f muß ... übernehmen hat ... zu übernehmen 23f Nachdem ich ... beleuchtet habe Indem es mir hiermit vielleicht gelungen ist, meinen Standpunkt von den wichtigsten Seiten aus zu beleuchten 7 sind frei erfunden sind alle fingiert 3 Beschreibung Charakterisierung 1 selber selbst
266/2f die Zeit ihres ... nur eine und dieselbe die ganze Zeit ihres ... nur EINE und DIESELBE 6 wenn ich zurück Und wenn ich zurück 8 dem wahren DEM WAHREN 16f die Mehrzahl von der Plural für 19 muß die Verwandlung des Sinnenmenschen zum Geistesmenschen erfolgen hat die Verwandlung des ANIMAMENSCHEN zum GEISTESMENSCHEN vor sich zu gehen 24 Zwiespalt Konflikt 27 ... Gott' oder 'Ich ... Gott' bzw. 'Ich ... 7 Menschen der Gewalt MENSCHEN DER GEWALT 6 seinem Triebleben gehorcht, das seiner ANIMA gehorcht, die 3 die Mehrzahl der Plural
267/3 entwickeln sollen ... geboren zu entwickeln haben ... GEBOREN 4 edeldenkend edel DENKEND 7f Faustmenschen Gewaltmenschen 9 verstehe meine 11 gesetzgeberische Gewalttätigkeit gesetzgeberische Gewalttätigkeiten 13 Dreißigjähriger dreißigjähriger 21f der gesellschaftliche, nicht Staatenfrieden der soziale usw., nicht nur der politische Streben danach Steben nach diesem letzteren 22f der Berta von Suttner der Suttner trotz dem russischen G. trotz des russischen G.s 7 der Edelmensch DER Edelmensch 6f der Gewaltmensch welcher DER Gewaltmensch Urbilder Typen 4 Kennzeichnung Charakterisierung 3 den Schauspielern den darstellenden Künstlern Anm ... Prophezeiung an. ... Prophezeiung an. (Die Herausger)
268/6 Afdala AFDALA 8 Gewalt Gewalttätigkeit 11 sind eben Edelmenschen sind eben EDELMENSCHEN 12 erziehen machen 13 möglich ist zu ermöglichen ist 16ff vorsichtiger Menschlichkeit und eindrucksvoller Kraft, die jedes Unrecht und jede Grausamkeit vermeiden VORSICHTIGER HUMANITÄT UND EIN DRUCKSVOLLER KRAFT, DIE JEDES UNRECHT und JEDE GRAUSAMKE1T vermeidet.
//49//
Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch l921
268/19 Geist GEIST Gewaltmenschen nicht besitzen gewalttägigen Animamenschen eben nicht besitzen 21 die Wissenschaft DIE WISSENSCHAFT 25 Vorbild Ideal 26 hält das rohe Denken des Triebmenschen hält die rohe Anima 7 daß das Triebleben daß die Anima 5f wird die Wissenschaft einsehen hat die Wissenschaft einzusehen sich geirrt hat und ... einschlagen muß sich geirrt und ... einzuschlagen hat
269/6 andre Wissenschaft andere Wissenschaft 10 'niederen' 'niedern' 2vu bildet BILDET Anm So auch Karl Ludwig Schleich, einer der ... So euch C.L. Schleich , der Arzt und Denker. (Die Herausgeber)
270/5 ist zu erwarten, daß es endlich auch steht zu erwarten, daß es endlich bald auch 6ff so muß ich ... betrachten so habe ich sie ... zu betrachten vom rein menschlichen vom REIN MENSCHLICHEN kirchlichen KIRCHLICHEN gar vom Standpunkt derSchriftgelehrten aus gar exegetischen Standpunkt aus 14ff menschlicheren ... Sie mußte humaneren ... Sie hatte ... zu 25 betrachtet, unbedingt betrachtet, ganz unbedingt 26 Einbildung Imagination 27f Eingebung Inspiration aller Klugheit und allem Scharfsinn aller ihrer Klugheit und ihres Scharfsinns 8 aus sich selber aus sich selbst
271/9 Länder Territorien 12 zu meinen zu kritisieren 15 richtig verstandene liebevolle richtig verstandene, humane 17 tritt auf kommt vor 20 als die 'Schwarzen' die man die 'Schwarzen' 23ff nachdenkende, ergebene Glaube nachdenkende Autoritätenglaube sein gesunder Menschenverstand seine natürlichen Instinkte zu grob beleidigt wird sich zu grob beleidigt fühlen 8 Scheike Scheiks 3 leichtbegreiflichen leicht begreiflichen 2 sind die Mehrzahl sind Plurale
272/11 ihnen erwarten Ihnen erwarten 14f um Vorteil zu erhaschen um ihren Vorteil zu besehen 17 beschämt sie alle. beschämt sie alle! 22 selber selbst 23f arabische Phantasie - Fantasia ARABISCHE PHANTASIE 26f ungeeigneten unpassenden 3 Tausende tausende
//50//
Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch l921
273/17f müssen ... höher suchen haben wir ... höher zu suchen 20 Nur wegen der An'allah Nur in Beziehung auf die An'allah 22f sehe ich mich gezwungen sehe ich mich dadurch gezwungen im übrigen wirklich im übrigen nur wirklich 24f tatsächlich in voller Wahrheit 8 eintreffen sollten einzutreffen hatten 6 aufs genaueste zu berechnen auf das Genaueste zu berechnen. - Man sieht, ICH HABE KEINESWEGS DIE ABSICHT, MAKALATURWARE ZU SCHREIBEN! 3 grober brutaler 2 bestehender Bau bestehender Bau, etwa so ähnlich wie der oft angeführte 'Zentrumsturm' der deutschen Katholiken.
274/17f kein Licht mehr gibt kein Licht mehr gab 19 heutzutag ... kann. heutzutage ... kann! 22 nicht mehr vorhanden nicht vorhanden 26 nur schaden nur noch schaden 27 Zähigkeit Gehässigkeit 5f an bis auf den heutigen Tag hat an bis auf das entsetzliche 'rote 'Lachen' unserer Tage hat 2 mit Stahl und Blei mit Säbel und Blei
275/2 niedermetzeln niedermachen 6 selber selbst 7 halten. halten! 8 Menschenliebe Humanität 12f an ihr und ... bei ihr AN ihr und ... BEI ihr 15 ins Auge fassen in die Augen nehmen 18 konnten: es ist konnten. Nämlich es ist 19 allgemeiner Menschenliebe Humanität 21 gehorchen müsse zu gehorchen habe 27 Zeit der Gewalt ZEIT DER GEWALT 9 wahren WAHREN 2 religiösen ... kirchlichen RELIGIÖSEN ... KIRCHLICHEN 1 Menschentums MENSCHENTUMS Menschen MENSCHEN
276/1 tu tue 2 diesen Geist diesem Geiste 17f morgenländisches Schattensp ORIENTALISCHES SCHATTENSPIEL geheimnisvolle Schachpartie GEHEIMNISVOLLE SCHACHPARTIE 25f wegfällt in Wegfa1l kommt 27 Hochgehn Aufgehn
277/2f der Hakawati ist der erstere IST 4f Triebmenschen Animamenschen Schefaka die letztere Menschenseele MENSCHENSEELE in der Richtung nach der Richtung 6 zum Geist zum GEISTE 9f bei der die Anführer auf der die Anführer 11 sollen. Stimmen sie zu, so sollen, auf deren Hilfe man rechnet. Sagen sie zu, so 15f ihm Gelegenheit für den Beweis zu geben, daß ihm Gelegenheit zu geben, zu beweisen, daß
//51//
Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch 1921
277/15f Sie ist nicht darauf eingegangen Sie ist aber zu stolz gewesen, darauf einzugehen 18f daß sie beschließt daß sie doch nun beschloß die längst verdiente die verdiente 20ff beabsichtigt sie beabsichtigte sie zu erschüttern und für das Edle zu gewinnen zu veranlassen, ein Edelmensch zu werden Dies ist von ihr längst vorbereitet Dies war von ihr schon längst in die Wege geleitet Forderung ein und sagt zu Forderung ein. Sie sagt zu 24 spielen. Sie spielen. Und sie 3f als auch ihr wie ihr bringen großes Gefolge bringen ein großes Gefolge 1 dabei viel geschmaust, und man muß die Gäste da viel geschmaust. Man hat die Gäste zu unterhalten
27S/6 die Todeskarawane über die Streitenden die fremde Todeskarawane über die sich Streitenden 9 begangen haben: sie ... begangen haben. Sie ... daran sein an ihr sein 16f Gedanken nichts Gedanken gar nichts 27 den Gedanken die Idee 9f das Schattenspiel leiten könne die Leitung des Schattenspiels 7 kommt selber kommt persönlich 5 daß die Phantasie mit der Menschheitsseele eins ist DAß DIE PHANTASIE MIT DER MENSCHHEITSSEELE EINS ist 1 geplanten obenerwähnten.
279/2ff Der Mensch, der sich ... DER MENSCH, DER SICH ... ehe der Kampf beginnt EHE DER KAMPF BEGINNT! 5 genug; die Menschheitsseele genug, so bringt die Menschheitseele 8 übernehmen soll zu übernehmen hat 9 eigne Bewandtnis eine gar eigene Bewandtnis 10 soll ... spielen soll nämlich ... SPIELEN 11 Bibel selber Bibel SELBST 19f Einer arabischen Phantasie ... unverwehrt, sich die Bibel Ebensowenig, wie es eine Sünde der Evangelisten ist, zu erzählen, daß Maria ihren Sohn vom heiligen Geist empfangen habe, ebenso wenig ist es einer arabischen Phantasie verboten, sich die Bibel 22 wie schon wie bereits 25f das heißt, von der kirchlichen und weltlichen Macht das heißt, infolge der damals noch übermächtigen religiösen und profanen Gewalttätigkeit 8f unterbrochenes großes Werk fortzusetzen unterbrochenes, großes Werk von neuem fortzusetzen
280/1 muß ... doch nur MUß ..., doch NUR 4 Schluß Beendigung 17 der Auftritt die Szene 22 außerordentlich viel geschadet außerordentlich geschadet 8f Völkerseelenkunde Völkerpsychologie 4 Menschlichkeit Humanität
//52//
Seite
ZeileBamberg Bd 49 Jahrbuch 1921
281/2 bettelt zu betteln hat 3f Recht verlangen, daß sie sich vor ihm Recht, zu verlangen, daß SIE sich vor IHM 7 wahren WAHREN 8 Gewalt Gewalttätigkeit 9 eben jetzt soeben jetzt 10f Bei ihrem Kommen Beim Kommen der letzteren 15 beginnt verständlicherweise beginnt ganz selbstverständlicherweise 16 Befreiung der Kunst BEFREIUNG DER KUNST 17 niedrigen 'Schattenspiels' NIEDRIGEN 'SCHATTENSPIELES' 18 hier anfassen HIER anfassen 22 von selber hervortreten von selbst und ohnedies hervortreten 24 Befreiung der Wissenschaft BEFREIUNG DER WISSENSCHAFT Glaubens GLAUBENS 25 erst dann erst sodann 27 Gegensatz Konflikt 7 der Kurbatsch, der Peitsche der Kurbatsch (Peitsche) 5f Gewalt, das derbe Triebleben Gewalt, der niedrigen ANIMA 3 Geistesmenschen GEISTESmenschen 1 nach Märdistan hierauf nach Märdistan
282/2 vollständig unblutig vollständig unblutiger 3 Summe von Machtentfaltung SUMME VON MACHTENTFALTUNG 4 um den niederen Geschöpfen um den Animageschöpfen 5 Befriedung Pazifikation 8 erfordert freilich Geist, viel Geist und mehr Geist erfordert aber freilich GEIST, viel GEIST und mehr GEIST 9 einfach nur einfach bloß nur 18 Innern liegen Innern liegt 19ff Seelenforschers Psychologen Theaterfachmanns Dramaturgen Und doch muß der Dramaturg zugleich auch Seelenkenner sein Und doch hat der letztere zugleich auch der erstere zu sein nur dann kann nur dann, wenn dies der Fall ist, kann - - (Montag, den 1.10.1906)

HERAUSGEBER UND VERLAG KARL - MAY-GESELLSCHAFT e.V. 2000 Hamburg 72 Swebenbrunnen 8c REDAKTION Hansotto Hatzig 6800 Mannheim 51 Nadlerstrase 40 DRUCKVORLAGEN Bernd Fischer Neunkirchen /Siegkreis LAYOUT Gerhard Klußmeier, Hamburg DRUCK Bruglacher, Hamburg